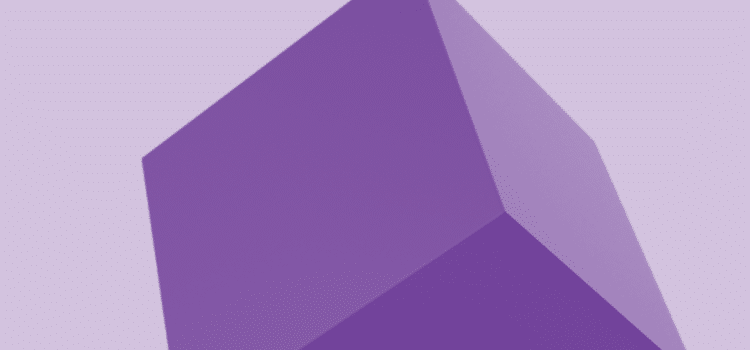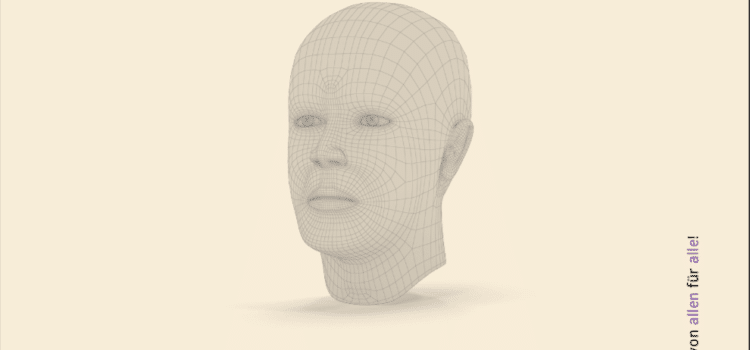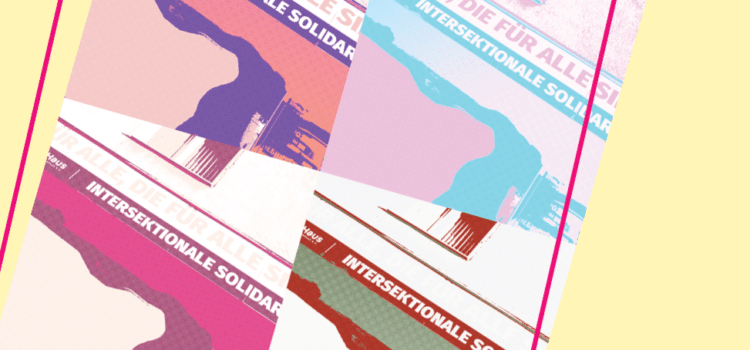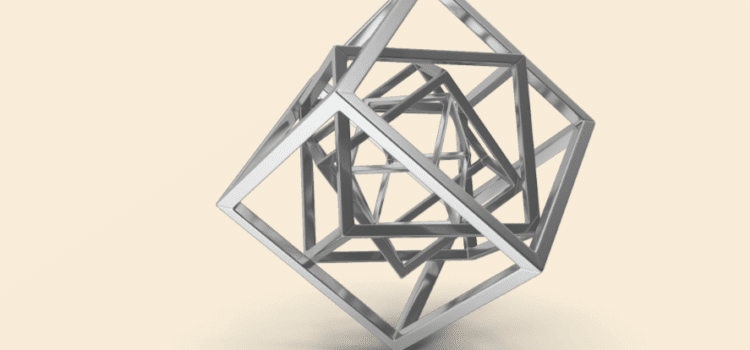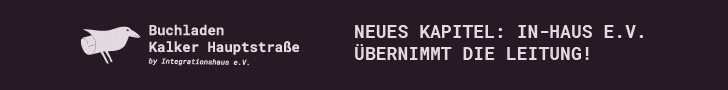A. Team- und Gruppenkonstellationen beachten
Gruppenkonstellationen in Einrichtungen sind unterschiedlich: homogen-weiße beziehungsweise mehrheitsangehörige Konstellationen, heterogenere Konstellation aus Schwarzen Menschen, Person of Colour und Indigious People und weißen Fachkräften etc. Die gesellschaftlichen Machtverhältnisse und verinnerlichten (rassistischen) Wissensbestände bilden sich häufig auch in den Teams ab. Es kommen sehr verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichem Vorwissen und vielfältigen Erfahrungshintergründen zusammen.
Mögliche Fragen zur Teamreflexion (nach LAG Mädchen*arbeit 2021):
- Welche Privilegien spiegeln sich in unserem Team wieder?
- Welche Reflexionsräume haben wir dafür?
- Welche De-Privilegierungen spiegeln sich in unserem Team wieder?
- Gibt es dafür Reflexionsräume (Safe(r) Spaces) und wenn nicht, wie können diese auch außerhalb der Einrichtung hergestellt werden?
Aufbauend auf der Diskussion dieser Fragen im Team (am besten unter externer Begleitung) kann gemeinsam diskutiert werden, welche weiteren Schritte – getrennt oder gemeinsam je nach Positionierung – gegangen werden können.
B. Gemeinsame Grundlagen schaffen
Grundlage rassismuskritischer Prozesse ist die Erarbeitung einer gemeinsamen theoretischen Grundlage (Wissensvermittlung) und eines gemeinsamen – bestenfalls institutionellen – Verständnisses von Rassismus. Dazu gehört es,
1. ein Bewusstsein über die eigene Berufsgruppenzugehörigkeit zu schaffen und den Einfluss dieser auf das berufliche Handeln zu reflektieren,
2. kritisch zu sein gegenüber Diskriminierungsfaktoren in der eigenen Einrichtung,
und
3. die Aneignung von Fähigkeiten, um Dialoge über Diskriminierungs-faktoren zu initiieren und in Gang zu halten.
Hilfreich sind entsprechende Teamworkshops. Neben der Wissensvermittlung sollte in den Workshops aber niemals die emotionale Komponente, die das Thema immer mit sich bringt sowie die Gruppendynamik vernachlässigt werden. Es können Prozesse und Dynamiken entstehen, die supervisorisch begleitet und/oder aufgefangen werden müssen. Hier ist ein multiperspektivisches Team hilfreich für die Begleitung eines solchen Prozesses.
Empfehlung: Multiperspektivische Teams sind für diesen Prozess unabdingbar: In einem diversen Team können unterschiedliche Erfahrungen und Wissensbestände auch unter den Durchführenden sichtbar gemacht werden und so eine Identifikation der Teilnehmenden mit verschiedenen Positionierungen ermöglichen. Dabei kann sich das Team auch darüber verständigen, wer in welchen herausfordernden Situationen vorrangig (re-)agiert. Um Machtverhältnisse bzw. in der Gesellschaft übliche Zuständigkeiten so wenig wie möglich zu reproduzieren (z.B. Rationalität und akademisches Wissen auf der weißen Seite, Emotionalität auf der nicht-weißen Seite) gilt es, dies zu reflektieren. Feedback und Auswertungsschleifen auch über die Rollenteilung im Team haben darin ihre große Bedeutung (vgl. Bildungsteam Berlin-Brandenburg, 2018: S. 8).
C. Prozessbegleitende Räume zur Reflexion der Praxis und zur Einübung einer reflexiven Haltung sicherstellen
Rassismuskritische Prozesse brauchen reflexive Orte, an welchen der Zusammenhang zwischen pädagogischem Handeln und den individuellen und institutionellen Rahmenbedingungen dieses Handelns reflektiert werden kann – insbesondere mit Blick auf Widersprüche, Dilemma und Ambivalenzen (vgl. Broden, 2017). Dabei muss ein doppelt angstfreies Klima herrschen: Die reflexiven Räume müssen davor schützen, dass Rassismus nicht unwidersprochen oder gar dethematisierend reproduziert wird. Dennoch muss es möglich sein, sich ohne die Furcht, „etwas Falsches‘“ zu sagen, äußern zu können (vgl. Weis 2017: S. 33). Die emotionale Auseinandersetzung geht auch mit der Suche nach Antworten auf Fragen einher, wie die gesellschaftliche Positioniertheit, damit verbundene Diskriminierungserfahrungen oder Privilegien, sich auf die tagtäglichen Erfahrungen und Verhaltensweisen auswirkt.
Die Ebene der Emotionen sollte deshalb in den diskriminierungskritischen Lernprozess ganz bewusst mit einbezogen werden. Die kritische Reflexion der eigenen Gefühle beim Sprechen und Lernen über Diskriminierung kann Teilnehmenden dabei helfen, den negativen Emotionen nicht mit Abwehrverhalten nachzugeben, sondern sie als Teil des eigenen Lernprozesses zu begreifen, sie im Hinblick auf strukturelle Diskriminierung zu hinterfragen und produktiv zu navigieren (vgl. Bönkost, 2019a: S. 2f.).
Fachkräfte of Color sind gleichzeitig in den Einrichtungen auch Vorbilder für Besucher:innen der Zentren. Sie sollten, angesichts ihrer selbst durchlebten rassistischen Erfahrungen Empowerment erfahren können, um behutsam mit eigenen Kraftressourcen umzugehen und zu lernen, ihre körperliche und psychische Unversehrtheit zu wahren.
Diese Phasen der Auseinandersetzung und Sensibilisierung könnten analog der Handlungsleitlinien teilweise getrennt und teilweise gemeinsam in multiperspektivischen Teams durchgeführt werden.
Nach einer ersten Sensibilisierungsphase könnte eine Praxisphase eingebaut werden (Nachhaltigkeit). Entweder ein kleines Praxisprojekt oder konkrete Arbeit an Fallfragen der Mitarbeitenden (supervisorisch begleitet) oder an konkreten Beispielen. Auch wäre ein langfristiger Begleitprozess sinnvoll, beispielsweise in regelmäßigen Abständen (z.B. halbjährlich) Gespräche oder Reflexionsrunden zum fortschreitenden Prozess von Veränderungen in der Einrichtung (vgl. hierzu auch die Arbeit von Bönkost/Apraku, 2019).
Empfehlungen: Nettiquette und gemeinsame Regeln am Anfang für Austauschräume festlegen wie z.B. :
- Im Rahmen des Austauschraums duzen wir uns.
- Bei digitalen Formaten: Es wäre toll, wenn alle ihre Videos einschalten, so dass wir uns gegenseitig sehen.
- Persönliche Themen, die wir ggfs. ansprechen, bleiben dort wo sie angesprochen wurden.
- Wichtig ist es auch, uns gegenseitigen Respekt und Wertschätzung entgegen zu bringen.
- Dies ist ein Raum für Lernen, Verlernen und Austausch.
- Unser Raum soll energiespendend und nicht raubend sein, d.h. es ist kein Platz für Intoleranz, Hass, Beleidigungen, sondern ein Ort für das Zuhören und die gemeinsame Entwicklung hin zur Gesellschaft, die wir uns hoffentlich alle wünschen.
- Trotzdem sind wir alle ganz sicher nicht fehler- oder vorurteilsfrei und lernen daher gemeinsam!
Katharina Debus (2021) hat in ihren Seminaren einige Wünsche an die Arbeitsweise und Lernatmosphäre formuliert, die sich auch gut auf Austauschräume (gemischte Räume, wie auch weiße Räume) übertragen lassen:
Gute Lernbedingungen zu Diskriminierungskritik sind:
- Lernende Grundhaltung, Selbstregulation, Freiwilligkeit, Selbstsorge
- Von Unterschiedlichkeiten in der Gruppe ausgehen
- Achtsamkeit mit Pronomen, Geschlechts- und Zugehörigkeitszuschreibungen
- Wissen nicht voraussetzen und gerne nachfragen
- Unsicherheiten formulieren können als Kompetenz (Kompetenzlosigkeitskompetenz)
- „ich“ statt „man“ bei persönlichen Aussagen
- Raum für Differenz und Grenzachtung bei persönlichen Fragen
- Ratschläge und Resonanz auf persönliche Erzählungen (Wünsche erfahren)
- Vorsicht mit Zuschreibungen und „Du-Botschaften“ (auch bei guter Intention)
- Fragen und Grenzsetzungen als Geschenk an den Kontakt
- Hilfestellungen bei Unsicherheiten
- Fehlerfreundlichkeit, Wohlwollen & Verantwortungsübernahme
- Bemühen um nicht-diskriminierendes Sprechen & Handeln
- Unterscheidung zwischen Intention/Absicht & Effekt/Wirkung
- Solidarische Kritik & kritische Solidarität als Bedingung für Lernen über Diskriminierung: spezifisch und handlungsbezogen
- Kontroversität & Wissen um eigenes Nicht-Wissen
- Blick für Spannungsverhältnisse & Ambivalenzen
- Interessierter Blick auf die eigenen Emotionen (davon lernen statt bewerten)
- Aufmerksamer Umgang mit Zitaten diskriminierender Begriffe
D. Hürden und Fallstricke
Es ist nicht einfach, die unterschiedlichen Wissensbestände und Bedürfnisse aufzugreifen, die nicht immer ausgehandelt werden können. Die folgenden Hürden haben wir gesammelt, weil wir darin nützliches Potenzial für die Weiterentwicklung des Austauschraumes sehen:
- Lernprozesse sind schwer zu begleiten – langfristig hält es uns als Gruppe eher auf, wenn wir versuchen, jeden Reflexionsprozess gemeinsam zu gehen und das sollte auch nicht der Anspruch sein;
- Nachhaltigkeit – über den Punkt des Austauschs hinaus in das tatsächliche Teilen von Privilegien und Macht zu kommen;
- Erwartung, dass der Raum ein „Selbstläufer“ ist – Räume müssen aktiv gestaltet werden und das erfordert das Aufrechterhalten von Motivation und der Bereitschaft „dranzubleiben“;
- Ressourcen und Zeitfaktor – es ist kein Bildungsseminar im klassischen Sinne, aber es geht auch nicht um eine reine „Freizeitbeschäftigung“;
- …und jetzt kommen wir zu dem Potenzial:
- Lernprozesse sind schwer zu begleiten – der Anspruch sollte nicht sein, immer zu wissen, in welchen Prozessen die Gruppenmitglieder sich gerade befinden, sondern eher das Wissen darum, dass wir uns alle individuell und kollektiv darum bemühen, die eigenen rassismuskritischen Lernprozesse aufrecht zu erhalten, auch wenn wir an unterschiedlichen Punkten sind;
- Nachhaltigkeit – der Austausch ist ein erster Schritt, um sich die eigenen rassistischen Denk- und Handlungsmuster bewusst zu machen, zu verbalisieren und zu reflektieren; Verbündetenschaft können wir als weiße Gruppe ohnehin nicht definierten, aber uns dabei ermutigen, „Braver Spaces“ im kleinen Rahmen zu kreieren, um für Alltagssituationen zu üben;
- Erwartung, dass der Raum ein „Selbstläufer“ ist – Gestaltungsfreiraum ist da, um genutzt zu werden und Routinen zu durchbrechen gehört dazu, wie in jeder anderen Lerngruppe, um Lerneffekte aktiv zu halten;
- Ressourcen und Zeitfaktor – das Setzen von Prioritäten ist als individuelle Aufgabe verbunden mit einer einfachen Rechnung, denn sie kann so viele Vorteile für die Gruppe bringen, wie Individuen sich daran halten.
Checklisten und praktische Tipps zur Unterstützung der Prozesse
Reflexion, Bestandsaufnahme und Maßnahmen betreffen verschiedene Dimensionen und Ebenen von Organisationen. Die Etablierung rassismus- und diskriminierungskritischer Reflexionsprozesse und Institutionalisierung dieser Prozesse ist als Organisationsentwicklungsprozess zu verstehen. Als Start bietet sich die Arbeit mit einem der zahlreichen Fragebögen und Checklisten an, die in den letzten Jahren entwickelt worden sind (zuletzt LAGMA*, aber auch von Seng und Bönkost). Nicht immer begibt sich eine gesamte Organisation auf den Weg zu einer rassismus- oder diskriminierungskritischen Öffnung. Häufig sind es einzelne Personen, die sich für Veränderungen stark machen. Ihnen kann der Fragenkatalog dabei helfen, Rassismus im Hinblick auf einen bestimmten Teilbereich der Organisation zu bearbeiten sowie als Thema handlungsorientiert einzubringen und zu einer Beschäftigung mit Veränderungsstrategien anzuregen (vgl. Bönkost 2019a: S. 7).
Literaturtipps für weiße Austauschräume (zum Einstieg in persönliche Auseinandersetzungsprozesse, aber auch für Diskussionen untereinander:
Hasters, Alice (2019): Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten.
Amjahid, Mohamed (2017): Unter Weißen. Was es heißt privilegiert zu sein.
Amjahid, Mohamed (2021): Der weiße Fleck. Eine Anleitung zum antirassistischen Denken.
Sow, Noah (2018): Deutschland schwarz weiß.
Ogette, Tupoka (2017): Exit Racism. Rassismuskritisch denken lernen.
Sebastian Seng (2017) schlägt zielführend im Sinne der Einführung von change Managementprozessen die Arbeit mit dem 3-Phasen-Modell von Kurt Lewin vor: “Spezifika wären dann in der ersten Phase, sich ein gemeinsames kritisches Verständnis von Rassismus und insbesondere von institutionellem Rassismus zu erarbeiten und zu reflektieren, welche Position man selbst im Rahmen rassistischer Normalität einnimmt. Im Rahmen der dritten Phase wäre es essenziell, dass sich Mitarbeiter*innen usw. kontinuierlich fortbilden können und Räume vorhanden sind, um die eigene Arbeit zu reflektieren“ (Seng ,2017: S. 14). Hilfreich sind auch die von ihm benannten Reflexionsfragen für Organisationsprozesse (vgl. Seng, 2017: S. 14ff.):
In der ersten Dimension der „Normen und Selbstverständlichkeiten“ geht es z. B. um:
- Das Selbstverständnis der Organisation und ihrer Mitarbeiter*innen, inwiefern also die Themen Rassismus und Rassismuskritik darin verankert sind.
- Die gemeinsamen Begriffsverständnisse.
- Die Frage, wie das Thema Rassismus besprochen wird: Wer ist dafür verantwortlich? Wie stehen die Leitungskräfte dazu? Wer wird in der Organisation willkommen geheißen und wer darf sich dort zu Hause fühlen?
- Die Frage, wie die Organisation mit Selbst- und Fremdbezeichnungen afrodeutsch, Schwarze Deutsche, Sinti, Ashkali usw. statt Migrant:in“, „Flüchtling“, „Ausländer:in“ usw.) umgeht.
- Die Frage, wie geht die Organisation mit Sprache im Sinne einer diskriminierungssensiblen Sprache um, wie mit Mehrsprachigkeit und dem Bedarf nach einer Sprachmittlung?
- Die Frage, welche Normalitätsvorstellungen z. B. die in der Einrichtung aufgehängten Bilder, Poster, Aktivitäten, Feste oder das angebotene Essen vermitteln.
- Die Frage, wie wird mit Rassismus und diesbezüglichen Beschwerden umgegangen.
- Die Frage, ob es bspw. ein Schutzkonzept, transparente Regelungen und Zuständigkeiten gibt.
- Die Frage, welche Ressourcen werden zur Verfügung gestellt, um Mitarbeiter:innen zu sensibilisieren und Betroffene zu stärken?
Fragen zur Organisation?
- Wer arbeitet in dieser Institution an welcher Position?
- Bilden die Mitarbeiter*innen den Querschnitt der Zielgruppe ab?
- Welche Sprachen werden gesprochen, welche Feste gefeiert?
- Gibt es den Raum und die Möglichkeit, angstfrei über Rassismuserfahrungen zu sprechen?
- Welche Mitspracherechte bestehen für alle?
- Fühlen sich die Mitarbeiter:innen sicher im Umgang mit Diskriminierungen?
- Ist sich das Team sicher, dass die Einrichtung ein demokratischer und menschenrechtsorientierter Ort ist?
- Gibt es für die Mitarbeiter:innen Räume der (Selbst)Reflexion, Supervision und Fortbildungsangebote?
- Herrscht eine fehlerfreundliche Kultur im Team (inkl. Leitung und Hausmeister:in?)
Personen
- Dabei geht es vor allem darum, die Zusammensetzung der Mitarbeiter:innen und Adressat:innen, die Art der Stellenbesetzung und den Stellenwert rassismuskritischen Wissens bei der Einstellung und Qualifizierung der Mitarbeiter:innen zu reflektieren.
Strukturen
- Hier gilt es zu überprüfen, wie Entscheidungen getroffen werden, Arbeitsabläufe organisiert sind, Finanzmittel vergeben werden und welche Rolle die Auseinandersetzung mit Rassismus in den Qualitätsstandards der Organisation spielt.
- Wer ist in Entscheidungsgremien repräsentiert?
- Wer weiß überhaupt, wie Entscheidungen getroffen werden?
- Wie werden Differenzkategorien, Stereotype oder Gleichheitsgrundsätze bei Entscheidungen genutzt und welche Auswirkungen haben Entscheidungen auf assistisch diskreditierbare Menschen?
- Wessen Erfahrungen werden überhaupt in die Entscheidungsfindung einbezogen?
- Mit welchen Organisationen kooperiert die Einrichtung? Werden z. B. Organisationen von rassismuserfahrenen Menschen in die Erarbeitung von Konzepten einbezogen?
Bei Angeboten und Aktivitäten
- Geht es um die Struktur der Teilnehmer:innen und Teamenden und darum, wessen Bedürfnisse und lebensweltlichen Erfahrungen in die Vorbereitung und inhaltliche Gestaltung von Lernangeboten einbezogen werden.
Bei der Gestaltung der Materialien der Organisation wäre bspw. zu beachten,
- wer die Organisation nach innen und außen repräsentieren darf.
- Mit welchen Bildern sich die Organisation darstellt.
- Wann in Materialien Differenzmerkmale und –kategorien zum Thema gemacht werden.
- Wann nicht und wie rassistisch diskreditierbare Menschen dargestellt werden, z. B. als Sonderfall oder Stereotyp?
- Wessen Wissen und lebensweltliche Erfahrungen spielen in den Materialien der Organisation eine Rolle?
Räume und physische Mittel sollten
- daraufhin überprüft werden, ob sie für alle zugänglich sind. Das hat gerade beim Thema Rassismus eine sozialräumliche Komponente.
- So wäre z. B. zu fragen, ob rassistisch diskreditierbare Menschen Angsträume durchqueren müssen, um die Organisation überhaupt erreichen zu können.
Fragen zu Angeboten, Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerk
- Wer macht wem welche bildungsrelevanten Angebote?
- Wer spricht? Wessen Perspektiven werden dargestellt bzw. gehört?
- Wessen Perspektiven werden nicht repräsentiert?
- Reflektieren die Bilder und die Sprache auf Veröffentlichungen, das Essen, Musik etc. bei Veranstaltungen, die Art und Weise der Kommunikation die gelebten Realitäten, Kulturen und Ästhetiken von nicht weißen Gemeinschaften?
- Finden die Veranstaltungen in weiß dominierten Räumen statt?
- Wer wird wie repräsentiert? z.B.: Sind Schwarze Menschen als Wissensträger:innen sichtbar und ganz selbstverständlich, beiläufig ein Teil des Geschehens bzw. autonome Akteur:innen?
- Wer wird nicht repräsentiert?
- Ist Ihre Organisation mit Organisationen, die von BIPoC´s geführt sind, vernetzt und in Bündnissen? Unterstützt Ihre Organisation ihre Projekte und Kampagnen?
- Suchen Sie Input und Beratung von solchen Organisationen für Ihre Entscheidungsprozesse (Angebot, Ansprache etc.)?
- Welches/wessen Wissen wird als relevant erachtet bzw. wie viel Raum wird welchem Wissen gegeben? Was fehlt? Wie können wir einen anderen Kanon schreiben?
- Was (und wer) wird als ›wissenschaftlich‹ und was als allgemeinbildender Wissenskanon angesehen, was (und wer) als unwissenschaftlich oder weniger wichtiges Spezialwissen abgewertet/ausgeschlossen?
- Wie wird die Einrichtung beschildert?
- Welche Broschüren in welchen Sprachen liegen aus?
- Wie können wir diskriminierungsärmere Räume schaffen?
Und nun?
Die Ausprägungen auf struktureller, institutioneller und individueller Ebene betrifft alle Mitglieder unserer Gesellschaft. Was bedeutet es, in diesen Strukturen mit der eigenen weißen Positionierung zu leben, zu arbeiten, zu sprechen etc.? Wie können sich weiß positionierte Personen kontinuierlich mit ihren Privilegien auseinandersetzen, diese teilen, sich solidarisch zeigen und so zu mehr Gerechtigkeit beitragen? Wie können sie Bündnisse schließen und Bündnispartner:innen sein? Diese und noch viel mehr Fragen bewegen uns täglich … Ein erster Schritt kann die Schaffung von Reflexionsräumen für weiß positionierte Menschen sein.
Für Menschen mit Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen ist die Suche nach Wegen und Strategien des Empowerment bis heute essentiell. Empowerment ist Befreiung in gesellschaftlichen Ungleichheits- und Unterdrückungsverhältnissen von und durch von diesen Verhältnissen betroffene Gruppen und Communities. Empowerment ist Ermächtigung, Selbstorganisation, Heilung und (Wieder-)Aneignung von Geschichten über und durch Menschen mit Diskriminierungserfahrungen. Empowerment erscheint im miteinander Handeln und Sprechen, im Vortragen, im Schreiben, in Symbolen, in Musik und Film, in der Kunst, in Büchern, in Podcasts, auf Veranstaltungen, im Stadtteil oder im digitalen Raum, in aktivistischen und politischen Kontexten und auch in Safer Spaces. Und Empowerment kann in Interkulturellen Zentren erfahren werden, da viele Zentren aus der Empowermentbewegung heraus gegründet wurden.
Wohl wissend, dass die strukturellen Rahmenbedingungen, Erfahrungswerte, Motivationen, Interessenlagen, politische Diversität sich in den jeweiligen Interkulturellen Zentren der Stadt Köln sehr unterschiedlich sind, haben wir zum Abschluss der Broschüre verschiede Organisationen aufgesucht und viel Literatur gesichtet. Aus den Erfahrungen haben wir einige Punkte zusammengestellt, die als Anregung für die Interkulturellen Zentren der Stadt Köln zur Schaffung von inklusiven Räumen dienen können. Es ist klar, dass es sich nicht um einmalige Aktionen handelt, sondern um einen Organisationsprozess. Deswegen geht natürlich nicht alles auf einmal, und vielleicht auch nie so, dass tatsächlich Räume für alle geschaffen werden können. Aber das Bemühen darum ist immer richtig.
Die Interkuklturellen Zentren engagieren sich weiterhin dafür, Orte für alle zu kreieren: empowernd und diskriminierungskritisch.
Neben des Engagements in den Interkulturellen Zentren, braucht es aber auch entsprechende sturkturelle Rahmenbedingungen. Zum einen ist die Schaffung von Räumen keine Projektartbeit, sondern eine daurende Aufgabe. Ohne eine strukturelle Förderung ist eine Realisierung der hier vorgestellten Räumen zur Reflexion und für Empowerment nicht möglich.
Zum anderen benötigt es die Anstrengung aller gesellschaftlichen Akteur:innen und vor allem der politischen Institutionen. Welche Vorstellung von Gesellschaft sind hier tragend und spiegeln sich in entsprechenden Programmen und Förderungen wieder? Wenn wir keine gemeinsame Vision haben, wie wir zusammenleben und miteinander kommunizieren möchten, wie wir Ressourcen teilen und Gemeinsames gestalten wollen, fehlt auch die Orientierung.
Eine Erarbeitung gemeinsamer Vorstellungen und der entsprechenden Rahmenbedingungen wird dazu führen, dass mehr diskrimnierungsfreiere Räume entstehen können. Deswegen freue wir uns, wenn in den nächsten Jahren eine Vision für das Miteiannder entwickelt werden kann.
Abschließend finden sich auf den folgenden Seiten Anregungen für die Praxis. Die Fragen können bei konkreten nächsten Schritten unterstützen. Sie sind nicht als abschließend zu verstehen, sondern sollen kleinen, mittleren und großen Organisationen helfen, Veränderungen unmittelbar bis mittelbar umzusetzen.
Wir danken allen, die für die Erstellung dieser Handreichung ihre Ideen und ihre Kritik eingebracht haben!
–
Dieser Artikel ist Teil unserer Publikation: “Handreichung: „Handlungsleitende Prinzipien. Safer Spaces für Schwarze Menschen, People of Colour und Indigenous People schaffen. Reflexionsräume für weiß positionierte Menschen initiieren” Weitere Informationen finden Sie hier
–