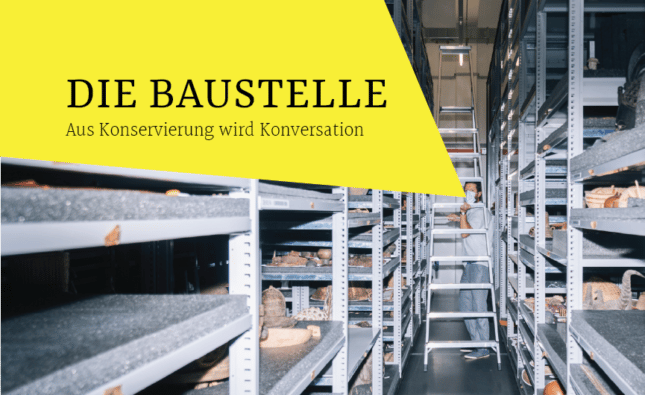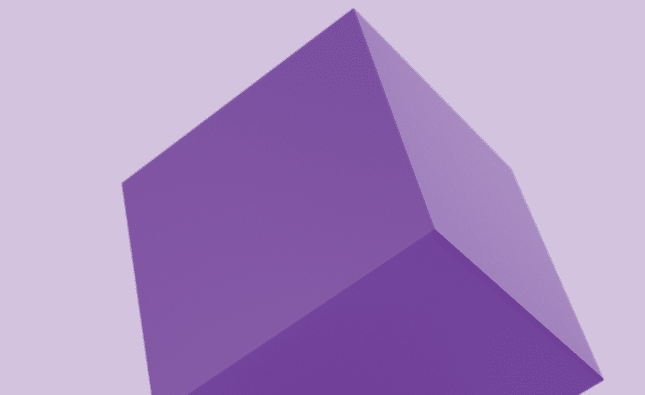von Alexander Estis
Seit vielen Jahren scheint sich der Betrieb abzumühen in seinen Versuchen, endlich diverser zu werden. Freilich kommt er dabei weder wirklich ins Schwitzen – noch über Versuche hinaus. Denn die Mittel, die bislang zur Anwendung kommen, sind meist scheinhaft. Und jene Diversität, die sich als Ausweis des Betriebs exponieren lässt, ist definitionsgemäß nicht die anzustrebende: Wäre sie erreicht, bräuchte es kein Exponiergehabe.
Quoten, Checklisten, Sonderprojekte, Schwerpunkteditionen dienen Kultureinrichtungen hervorragend dazu, sich zu profilieren und die eigene Diversität zu inszenieren. Echte Vielfalt wird dabei höchstens als sporadischer Nebeneffekt erreicht.
Gerade Quoten bleiben – so notwendig sie in bestimmten Bereichen sein mögen – oftmals nur ein sehr grobes Werkzeug, das insbesondere intersektionale Aspekte meist nicht adäquat zu erfassen vermag: Wird eine pauschale Kategorie wie „Frauen“ per Quote bevorzugt, können jüngere privilegierte Frauen in den Fokus rücken, während gleichzeitig von mehrfacher Diskriminierung betroffene Personen, wie beispielshalber ältere Männer mit Migrationshintergrund und aus niedrigen sozialen Schichten, aus dem Blickfeld geraten. Jeweils nicht fokussierte Merkmale, die aus einer intersektionalen Perspektive unbedingt zu berücksichtigen wären, fallen bei Quotenregelungen oft gänzlich weg – und die jeweiligen Personen durch das Raster. So setzen sich spezifische Diskriminierungen teilweise in explizit gegen Diskriminierung gerichteten Maßnahmen fort oder werden durch diese Maßnahmen sogar zementiert, auch wenn andere spezifische Diskriminierungen dadurch auf kurze Sicht korrigiert werden.
Checklisten degradieren Diversität zu einer abzuarbeitenden Trockenübung. Sonderprojekte sind punktuell, in ihrer Konzeption oft sehr eng gefasst und bewirken keinen Strukturwandel. Besonders charakteristisch – und in ihrer Genese durchaus nachvollziehbar – sind gutgemeinte Maßnahmen, die zwar Vielfalt fördern sollen, die Geförderten jedoch auf deren jeweils als förderwürdig angesehene Spezifik festschreiben. So existiert beispielshalber zwar ein Literaturpreis „für deutschsprachige Autorinnen und Autoren nichtdeutscher Muttersprache“, was an sich sehr begrüßenswert erscheint. Eingereichte Texte müssen jedoch Migrationserfahrungen thematisieren, was das ganze Unterfangen in ein dubioses Licht setzt. Tatsächlich entspringt es in letzter Konsequenz auch einer diskriminierenden Wahrnehmungsverzerrung, wenn Kulturschaffenden aberkannt wird, Kunst jenseits von ethnisch gebundener oder migrantisch perspektivierter Produktion erschaffen zu können. Auf diese Weise werden Akteure zu innerbetrieblichen „Quotenmigranten“; wahre, auch ästhetische Diversität wird auf diese Weise jedenfalls nicht erreicht.
Damit ist ein überall wiedererkennbares Grundmuster von Förderverfahren angesprochen, das migrantische Kunst nur in einer ganz konkreten, den eigenen innerbetrieblichen Anliegen jeweils dienlichen Ausprägung als förderwürdig anerkennt, diese konkrete Ausprägung überproportional repräsentiert und trotzdem weiterhin vom regelhaften Betrieb abspaltet. Von Migrierten zu migrantischen Themen geschaffen, bleibt sie eben immer „migrantische Kunst“ – im besten Fall noch mundgerecht aufbereitet nach dem jeweils modischen Geschmack des deutschländischen Betriebs, ganz wie pseudoasiatisches Essen für den europäischen Gaumen.
Die immer wieder beschworene Erfahrung der Andersheit kann sich nicht einstellen, wenn etwa in den Fördermechanismen des Literaturbetriebs eine tatsächlich fremdartige und damit möglicherweise befremdliche Ästhetik hinter immergleichen Migrationserzählungen zurückstehen muss.
Ebenso wie die Kunstprodukte in ihrer Qualität bleiben vielfach auch die migrierten Personen selbst in ihrer Qualifikation verkannt. Konzertmusiker müssen auf der Straße spielen, Künstlerinnen, in ihrem Herkunftsland von nationalem Rang, werden von hiesigen Galerien ignoriert, Schriftsteller fremder Sprache werden zu Tagelöhnern, weil sie schon an den bürokratischen Hürden der Antragstellung verzweifeln müssen.
Kaum vorstellbar, welche kulturellen Humanressourcen in Deutschland aufgrund derartiger absurder Mechanismen verlorengehen. Dies gilt, wie Mark Terkessidis anhand einer Anekdote schildert, insbesondere auch für den Nachwuchs:
„Ein plastisches Beispiel kommt aus dem Kulturbereich. Als Mustafa Akca durch das Projekt ,Türkisch – Oper kann das‘ an die Komische Oper in Berlin kam, stellte er fest: Im Kinderchor der Oper singt kein einziges Kind mit türkischem Hintergrund. Angesichts der hohen Zahl von Bewohnern türkischer Herkunft in Berlin erschien das erstaunlich: Wie war es möglich, all die potentiellen Kandidaten fernzuhalten? Dies hatte natürlich mit den Netzwerken zu tun, aus denen Einrichtungen der Hochkultur gewöhnlich ihren Nachwuchs rekrutieren – bildungsbürgerliche Familien deutscher Herkunft, die eine Affinität zu diesen Orten mitbringen. Akca lancierte einen schlichten Aufruf in ,Metropol FM‘, Berlins größtem Sender in türkischer Sprache, und siehe da: Etwa 200 Familien meldeten sich und waren sehr interessiert daran, ihre Kinder in diesem Chor unterzubringen. Diese Aktion erweiterte das Netzwerk über die Änderung der Kommunikationskanäle.“
(Terkessidis 2017: 50)
Trotz solcher erfreulichen Beispiele, die leider Einzelbeispiele bleiben, darf man sich nicht auf zufällige Eigendynamiken des Betriebs verlassen, um diese versteckten personellen Ressourcen nutzen zu können. Auch migrantische Personen, die im Kulturbetrieb bereits involviert und arriviert sind, müssen nicht zwingend die besten Ansprechpartner für die Umsetzung von Diversitätsbestrebungen sein – sofern es denn überhaupt als ihre Aufgabe deklariert, honoriert und gewürdigt werden kann. Da die Knappheit der Mittel im Kulturbetrieb leider allenthalben Konkurrenzen, Animositäten und Seilschaften provoziert, können und müssen diese Personen im Einzelfall ganz eigene Interessen verfolgen. Auch individuelle ästhetische Präferenzen können sich hier hinderlich erweisen und konkurrierende künstlerische Programme ausschließen.
Außerdem erlangen auch migrierte Personen nicht schon qua Herkunft oder Fluchterfahrung eine Expertise für strukturelle Probleme des Betriebs und deren mögliche Überwindung. Hier sollten, wie unten auszuführen sein wird, kompetente und professionell mit diesen Problemen befasste Organisationen (wie das Integrationshaus e.V.) herangezogen werden. Kurzschlussreaktionen, wie sie etwa im Kontext von „kultureller Aneignung“ oft erfolgen, gehen nicht selten fehl. Bekannt sind beispielshalber Bestrebungen im Theater, die zwar einem antidiskriminatorischen Impetus folgen mögen, aber selbst zu neuen Diskriminierungen führen können. Wenn zum Beispiel Vertreterinnen oder Vertreter der Mehrheitsgesellschaft daran gehindert werden sollen, Minderheiten zu spielen, kann dies schnell dazu führen, dass Minderheiten eben auf die Darstellung von Minderheiten festgeschrieben werden – wogegen man lange Jahre anzukämpfen hatte.
Schon anhand dieser streiflichtartigen Einblicke dürfte deutlich werden, dass Maßnahmen zur Diversifizierung des Kulturbetriebs, die auf den ersten Blick naheliegend scheinen, auf Dauer wirkungslos bleiben und sich sogar nachteilig auswirken können. Im Umkehrschluss mögen die meiner Einschätzung nach angeratenen Vorgehensweisen zunächst kontraintuitiv klingen. Sie tragen aber auch der besonderen Dynamik der Kulturarbeit Rechnung. Die Diversifizierung im Kultursektor wird nämlich – ungeachtet seiner konstitutionellen Besonderheiten – allzuoft schablonenhaft mit den gleichen Methoden vorangetrieben, wie sie in ganz anderen Sektoren Anwendung finden – und in erster Linie auf Inhalte und auf personelle Identitäten abzielen.
Um hier korrektive Tendenzen anzuregen, werden im Folgenden einige Empfehlungen ausgesprochen, die einer „Demonotonisierung“ des Kulturbetriebs auf lange Sicht förderlich sein können. Weder handelt es sich hier um eine Checkliste, die Punkt für Punkt abgearbeitet werden müsste, noch um eine Handreichung für ausschließlich top down umzusetzende Weisungen und Verwaltungsakte. Vielmehr versammelt die folgende Aufzählung programmatische Denkanstöße, die sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit, sowohl von koordinierenden kulturpolitischen Stellen als auch von kleinen Kulturinstitutionen je nach verfügbaren Ressourcen in die eigene Praxis eingebracht werden können – ob bei der Mittelverteilung, der Kurationstätigkeit, der Veranstaltungsplanung, der Mitarbeitendenrekrutierung, der Ausschreibungspraxis, der Prämierung oder der Jurierung.
Dieser Artikel ist Teil unserer Publikation: “Vielheitsplan Kultur – rein praktisch!” Weitere Informationen finden Sie hier