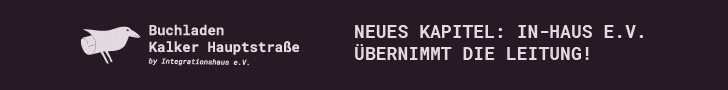Solidarität von weißen Menschen?
Elizaveta Khan und Andreas Fischer: Im folgenden Einleitungstext bringen wir unsere Gedankengänge rund um Solidarität und die eigene Positionierung in Form eines Dialogs zusammen. Damit wollen wir transportieren, dass der Diskurs lebendig ist, dass wir uns streiten werden und müssen, und dass wir uns (wieder) kritisch mit Strukturen und Ungleichheiten in unserer Gesellschaft auseinandersetzen müssen, statt (nur) Meinungen auszutauschen. Vielleicht können wir dann solidarisch an einer gerechteren Gesellschaft und der Teilhabe an Ressourcen von allen arbeiten.
Elizaveta Khan: Zunächst einmal möchte ich die Ausgangslage unserer Diskussion skizzieren. Denn wie überall gibt es auch in unserem Gesprächsraum unterschiedliche Wissensbestände und Zugänge. Worüber sprechen wir also? Rassismus ist eine unsere Welt und Gesellschaft strukturierendes Merkmal. Gewachsen ist das rassistische System in jahrhundertelanger Tradition. In dieser Tradition schufen weiße Menschen eine Welt für sich. Eine, wo Menschen, die nicht diese Hautfarbe hatten, zu einer niederen Klasse Mensch deklariert wurden. Eine Welt, wo sich weiße Menschen an Natur und Mensch bedient haben, wie sie es brauchten. Ohne Rücksicht. Wir müssen uns bewusst darüber sein und aufzeigen, dass „weiße Europäer_innen und Nordamerikaner_innen die Welt nicht nur militärisch und wirtschaftlich dominier(t)en. Sie vermittel(te)n auch kulturell ihre Perspektiven/Interpretationen und Umgangsweisen, ihr Wissen und Geschichten als wahr und überlegen” (Richter, 2015, S. 227). Und sie konnten und können bestimmen, welche Lebenswirklichkeit sichtbar wird, und somit auch relevant. Deswegen ist es so schwer über dieses System zu sprechen. Wir stecken alle drin. Und Rassismus ist überall.
Andreas Fischer: Gerade diese historische Dimension von Rassismus fehlt allerdings häufig in den Diskussionen, was unter anderem damit zu tun hat, dass es viele ungehörte Geschichten zur Geschichte gibt und eine eurozentristische Perspektive unmarkiert als Universalgeschichte fungiert. Daraus folgt, dass die eigene Position die Erzählperspektive ist und daher die ‘Anderen’ als die ‘Anderen’ markiert werden. Daraus folgt auch, dass Rassismus nicht nur auf individueller Ebene wirksam ist, sondern aufgrund der Geschichte strukturell und institutionell verankert ist. Ich bin auch rassistisch sozialisiert und daran gewöhnt, aus einer weißen Norm heraus zu denken, und unreflektiert Kategorien zur Bezeichnung ‘Anderer’ zu benutzen; auch in Kontexten, in denen eigentlich Individuen im Mittelpunkt stehen sollten. Auch kenne ich viele widerständige nicht-eurozentristische Narrative und Stimmen nicht, die einen anderen Blick auf die Geschichte ermöglichen würden. Ich nehme die Möglichkeit, diesen Stimmen Gehör zu schenken nicht wahr, weil meine Welt auch so funktioniert.
Elizaveta Khan: Sich damit auseinanderzusetzen ist also ein aktiver Akt. Und ich frage mich, warum weiße Menschen solche Probleme damit haben, wenn sie weiß genannt werden? Es gibt keine Probleme, sich solche Begriffskonstrukte wie „Mensch mit Migrationshintergrund” auszudenken, und all die anderen Begriffe für die Menschen, die nicht weiß sind, die an sich ja nur eins beschreiben: Wir sind nicht gleich (viel wert). Und es gibt Unterschiede. Es gibt keine Welt, die, sowohl in der Vorstellung als auch in der Realität, nicht geprägt ist. Und zwar durch Geschlechter, Geschlechtsidentitäten, Klasse, Ethnizität, Hautfarben, Hintergründe – nur um einige zu nennen. Es gibt oft so eine Verteidigungshaltung, wenn weiße Personen als weiß markiert werden.
Andreas Fischer: Es ist ungewohnt und beschämend, sich der eigenen Position und des Teilhabens am ‘Benennen’ bewusst zu werden. Es ist schwierig, diese Scham anzunehmen und produktiv werden zu lassen. Oftmals liegt eine Verteidigung oder ein Gegenangriff näher, um den positiven Selbstbezug zu erhalten, statt sich mit der eigenen Position in gesellschaftlichen Strukturen auseinanderzusetzen.
Elizaveta Khan: Bei der Selbstbezeichnung können weiße Menschen also viel von uns, People of Colour, lernen. Wir, People of Colour, sind es ja gewohnt, bezeichnet zu werden, diese Erfahrung können wir teilen. Es ist ja auch ein Akt der Selbstermächtigung im Sinne von Selbsterkenntnis, und vielleicht eine Art neue Aufklärung – bei der dann alle mitmachen können.
Andreas Fischer: Und ich glaube genau das ist in vielerlei Hinsicht wichtig: Zuhören und bestehen lassen und weniger entweder oder, sondern mehr sowohl als auch zuzulassen.
Elizaveta Khan: Meine Theorie ist ja: Wir, vor allem wir weiße Menschen, wollen alle gut sein. Es darf keine Ungleichheiten geben, denn das ist nicht gut. Wir wollen keine Unterschiede zwischen Hautfarben, Geschlechtern etc. haben. Und deswegen wehren wir uns so gegen die Benennungen. Denn natürlich sind wir nicht gleich, es gibt keine Chancengerechtigkeit. Und das ist kein Schreckensszenario, das sind wissenschaftliche Erkenntnisse.
Andreas Fischer: Auch wenn unser aller Ziel Chancengerechtigkeit ist, müssen wir auf dem Weg dorthin zunächst bestehende Ungleichheiten benennen und sichtbar machen. Wir müssen den Fokus auf unterschiedliche Lebenswirklichkeiten legen und negativ von Rassismus betroffene Menschen in die Position des Sprechens und des Gestaltens bringen.
Elizaveta Khan: Und solange wir bestehende Ungleichheiten nicht benennen, sondern nur die Menschen bezeichnen, die davon negativ oder positiv betroffen sind, wird sich auch nichts ändern. Denn am Ende geht es um das Teilen. Um das Teilen von Ressourcen, aber vor allem um das Teilen von Wissens- und Deutungsmacht. Und deswegen ist der erste Schritt das Benennen und die Positionierung. Die Arbeitshilfe soll Anregungen dazu geben das oft nicht Markierte zu markieren: den weißen Menschen und was es bedeutet als weißer Mensch in dieser Gesellschaft aufzuwachsen und zu leben.
Andreas Fischer: Hinzuzufügen ist vor allem der Raum für die Reflexion und der Austausch darüber.
Elizaveta Khan: Und das ist alles so komplex und wirkmächtig, und gegen unsere gewohnte Art nicht lösungsorientiert. Deswegen sind Räume zum Denken und Fühlen wichtig. Und ich denke, wir können den Begriff der weißen Positionierung nutzen, um diese Privilegien, die damit zusammenhängen, zu verdeutlichen. Und es darf natürlich nicht bei der Reflexion bleiben, es muss zum Handeln kommen.
Andreas Fischer: Es geht also nicht nur darum, sich diese Verstrickungen bewusst zu machen, sondern machtbewusst zu handeln; die eigenen Privilegien für einen strukturellen Wandel zu nutzen und Räume zu schaffen.