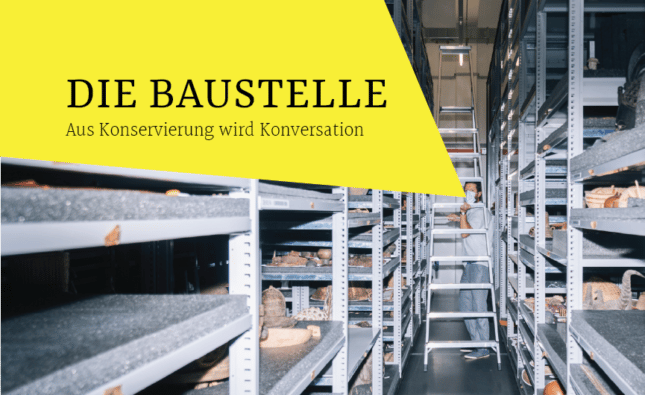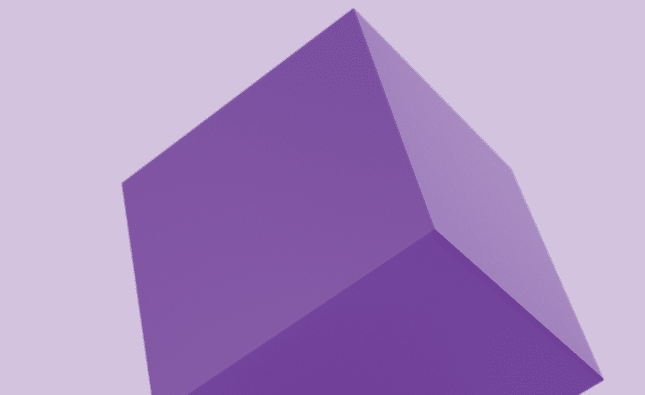von Alexander Estis
Vor mittlerweile gar nicht mehr so kurzer Zeit war ich ein kleines Kind aus Moskau, das in einem Hamburger Vorort mit deutschen Kasusendungen kämpfte und überhaupt versuchte, möglichst deutsch zu werden. (Zum Glück sind Kasusendungen dafür keine Voraussetzung, sonst hätte so mancher Patriot keine Nationalität mehr.)
Ich lernte aber auch, und das war dann doch eher meine russische Prägung, auf dem Akkordeon zu spielen. Und wissen Sie, wer mir, dem Jungen aus Moskau, die ersten russischen Volkslieder beibrachte? Ein älterer deutscher Herr, der sie in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft einstudiert hatte. Wenn er Katjuscha oder Kalinka oder Schwarze Augen spielte, überzog eine wahrhaft sibirische Melancholie sein Gesicht. Und wenn er von der Zeit der Kriegsgefangenschaft erzählte, hätte man meinen können, das sei die schönste in seinem Leben gewesen, denn, so seine Worte, damals habe er wahre Kameradschaft gefunden – und die Musik.
Kunst kann in und aus größter Not entstehen, auch im Krieg, das wissen wir alle. Aber niemals kann wirkliche Kunst für den Krieg entstehen, für Spaltung, für Menschenfeindlichkeit. Das ist banal und pathetisch, aber es ist wahr.
Echte Bildung zur Kunst ist immer auch Bildung zu Frieden und Freiheit. Dazu muss die Kunst jedoch von sämtlichen Zweckbestimmungen frei bleiben – nicht zuletzt auch von diesem Bildungszweck selbst. Andernfalls verkommt sie zur plumpen Didaxe, degradiert zu einer mehr oder minder künstlerisch verbrämten Moralunterweisung. Nicht nur keine kulturelle Bildung ist eine Gefahr, sondern auch eine zu kurz gedachte kulturelle Bildung: Eine solche, die Kultur und Kunst an pädagogische Zwecke bindet und damit verhindert, dass Kunstwerke die spezifischen ästhetischen Erfahrungsweisen anstoßen.
Wenn ein Drama in der schulischen Interpretation immer nur eine klare moralische Botschaft vermittelt, die man fein säuberlich von der Tafel ins Heft abschreibt, um sich dann dem nächsten Objekt interpretativer Verwertung zuzuwenden, gleicht man einem Touristen, der das Pantheon mit seinem iPhone fotografiert und sogleich zum Jardin du Luxembourg weiterläuft. Denn die simplifizierte, mundgerechte Aufbereitung von kulturellen Häppchen leistet dem vorherrschenden Konsumismus Vorschub.
Kulturelle Bildung bedeutet aber eben auch die Auseinandersetzung mit dem Komplexen, dem Uneindeutigen, mit dem Schmerzvollen. Das ist in uns allen drin, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Also sollten wir uns dessen besser bewusst sein.
Ähnlich verhält es sich mit politischer Bildung durch Kunst. Partizipation an Kunst ist immer auch Partizipation am demokratischen Prozess. Man sagt uns daher: Kunst soll politisch sein. So weit, so gut. Nur: Was heißt „politisch“? Offenbar darf Kunst heute nur solange als politisch gelten, wie sie unmittelbar auf das tagespolitische Geschehen bezogen bleibt: Indem sie „hinterfragt“, „kommentiert“, besser noch „interveniert“, oder zumindest eine eindeutige „Message“ präsentiert. Andernfalls hat sie wenig Aussicht auf Förderung.
Das ist zu kurz gedacht. Warum sollte Kunst, die den Menschen in seinem Innersten ergreift, durchdringt, bewegt, die sein Dasein in den Grundfesten erschüttert, ihm den Schleier seiner üblichen Weltsicht von den Augen reißt und ihm mit dem ganz anderen konfrontiert – warum sollte diese Kunst nicht politisch sein?
Die Vorstellung, Kunst müsse sich als solche ständig tagespolitisch engagieren, erzeugt eine Kunstform, die den Menschen nicht auf lange Sicht bildet, sondern ihn bestenfalls in kurzzeitigen Aufruhr versetzt, in einen konformistischen Trubel, dem tiefere Orientierung fehlt. Künstlerische Arbeit wird so letztlich identisch mit politischem Aktivismus und journalistischer Leitartikelproduktion.
Richtet sich Kunst in solchem Maße an kunstfremden Kriterien aus, gibt sie ihr Innerstes preis. Sie verzichtet damit auf ihr eigengesetzliches und apriorisches Existenzrecht und verliert ihre ureigene formale Widerständigkeit, sodass sie in letzter Konsequenz von politischen Agenden vereinnahmt werden kann. So wird vermeintlich politische Kunst zu einer reinen Stichwortempfängerin der Politik.
Es gilt daher, die besondere Eigenart der künstlerischen Welt- und Selbsterfahrung zu schützen. Kunst braucht – wie jedes andere humane Gut – nicht nur Frieden, sondern mit ihm auch Freiheit, Freiheit von ausnahmslos allen Vereinnahmungen, Indoktrinationen und Zweckansprüchen. Nur dann kann sie das leisten, was nur sie leisten kann.
In zunehmendem Maße und gerade in Zeiten der Pandemie erleben wir jedoch, wie der ubiquitäre Utilitarismus seine garstigen Finger auch um den Hals der Kunst legt. Die Politik kolportiert das kurzsichtige Kriterium der Systemrelevanz: Kultur sei keinesfalls überlebenswichtig, heißt es da etwa, man könne das Theater durchaus eine Zeitlang entbehren. Gewiss, eine Schließung der Theater für einige Monate führt nicht zu einem Massensterben von notorischen Premieregängern. Und wir können nun hoffen, dass die Schließungen ohnehin der Vergangenheit angehören.
Es bleibt allerdings die Frage: Welche Konsequenzen, welche Lehren wollen wir aus alledem ziehen? Wollen wir die plumpe Kulturfeindlichkeit der Politik und ihre Rhetorik der Ignoranz unerwidert lassen?
Die Initiative „Kultur ins Grundgesetz“ ist eine wichtige und dringend notwendige Erwiderung auf diese kulturfeindlichen Tendenzen. Sie fordert ein, dass dem hohen verfassungsrechtlichen Rang der Kultur ebenso vorbehaltlos entsprochen wird, wie der Gesetzgeber dies vorsieht. Zusätzlich sollten Vielheitspläne Wege zu einer uneingeschränkten Teilhabe am und Kulturbetrieb un zu dessen Diversifizierung weisen.
Diese Programmatik hebt auf ein anderes Argumentationsniveau ab als viele andere Forderungen von Kulturtätigen. Oft arbeiten diese nämlich mit gutgemeinten Legitimierungsversuchen des Kulturbetriebs: So unterstreichen sie etwa, dass Kunst und Kultur wichtig sind, weil sie einen Bildungsauftrag erfüllen, Aufklärungsarbeit leisten, in schweren Zeiten erbaulich wirken, das Gemeinschaftsgefühl stärken und den gerade jetzt so vermissten persönlichen Austausch förderten – kurzum, dass sie relevant und systemrelevant seien. Das ist auf triviale Weise richtig, und es kann nur traurig stimmen, dass man diese Selbstverständlichkeiten überhaupt auszusprechen braucht. Zugleich bleiben diese Argumente nicht ganz unverfänglich.
Denn sie übernehmen ein Stückweit die pragmatistische Logik der sogenannten Entscheider, die außerhalb des Kulturbereichs stehen und denen die fundamentale Notwendigkeit von Kultur offenbar alles andere als evident ist. So verständlich dieses legitimatorische Vorgehen also auch sein mag, verkauft es Kunst weit unter Wert – indem es ein erratisches Wertesystem reproduziert.
Darin spiegelt sich nämlich die Tendenz wider, Kultur als Mittel zu einem vermeintlich übergeordneten, wichtigeren, bestenfalls „handfesten“ Zweck zu begreifen. Doch Kunst ist nicht für etwas anderes da, für Politik, Demokratie, Umwelt, Bildung oder Gesundheit – auch wenn sie auf all diesen Terrains Großes leisten kann. Nein: Kunst gehört zu den wenigen Aspekten unseres Lebens, die sich außerhalb von dessen Erfordernissen und Zwängen konstituieren, den Sinn also nicht aus diesen beziehen, sondern wirklichen Sinn überhaupt erst zu stiften vermögen. Wir brauchen Kunst nicht für etwas – sondern für uns. Jede andere Begründung ist nichts als ein Zugeständnis an horizontbeschränkte Zweckrationalitäten.
Die Existenz und Bedeutung von Kultur muss nicht begründet werden, sondern umgekehrt sollten kulturfeindliche Tendenzen in einer Kulturgesellschaft unter Rechtfertigungsdruck stehen: Wenn Kultur aus Sicht eines Systems nicht relevant ist, dann sollte man dringend nach der Relevanz dieses Systems aus Sicht der Kultur fragen.
In solchen Diskursen wird Kultur nämlich immer wieder als etwas von unserer übrigen Zivilisation Abtrennbares vorgestellt – als eine Art sekundäre Komponente. Kultur gewissermaßen als Autoradio: Nett, wenn man es hat, aber das Auto fährt auch ohne. Die Tragweite dieses Selbstbetrugs kann man kaum überschätzen. Denn alle Sphären des geistigen und überhaupt gesellschaftlichen Lebens sind eng verwoben. Die Relativierung kultureller Werte ist daher das nicht minder hässliche und ebenso bedrohliche Zwillingsmonster des grassierenden Antiszientismus: Beides, Wissenschafts- wie Kulturhass, entspringt einem im Kern zivilisationsfeindlichen, gegenaufklärerischen, menschenverachtenden Impetus. Was uns droht, wenn Kultur und Wissenschaft abgewertet werden, ist nichts Geringeres als eine perfekte Vertierung.
Um vermenschlichend zu wirken, muss die Kunst, wie ich nicht müde werde zu betonen, von allen Zwängen frei sein. Geistig unfreie Kunst verfolgt Zwecke, die ihr von außen aufgetragen werden. Sie wird Trägerin einer Ideologie, einer Religion, eines politischen Programms. Natürlich ist die Kunst seit Jahrtausenden darin geübt, auch dann zu größter Freiheit aufzusteigen, wenn sie vereinnahmt wird. Genau das zeigt ihr Vermögen, Freiheit zu schaffen und zur Freiheit zu bilden. An diesem Streben aus den vorgesetzten Grenzen hinaus wird deutlich, dass der Wille zur Freiheit für die Kunst wesentlich ist. Er ist sowohl ihre Bedingung als auch ihr Resultat.
Menschen verfolgen sehr unterschiedliche Ziele – und meist ihre ganz eigenen Interessen. Daher sind die Logiken der Zwecke eher trennend und nur partikulär verbindend. Sie führen dazu, dass wir andere Menschen als Mittel oder sogar Hindernisse wahrnehmen und sie danach einteilen, ob sie unseren Zwecken entsprechen oder nicht. Wie man sagt: Ein Hammer sieht überall Nägel. In der Befreiung vom Zwang der Zwecke liegt nicht nur eine große Entlastung unseres Denkens und Fühlens, sondern auch die Chance zur Gemeinschaft. Außer der Kunst gibt es für den Menschen nicht viele Bereiche, in denen er kein Nagel sein muss.
Wir wissen, dass unsere Zwecke unterschiedlich sind, dass wir unterschiedliche Prioritäten setzen, unterschiedliche Weltbilder haben, dass wir uns also in vielen Dingen nie einig werden können. Das ist gerade in der Pandemie besonders deutlich geworden – sie hat selbst zwischen Freunden tiefe Gräben gezogen. Dies zu akzeptieren, fällt schwer. Doch Humanität bedeutet, den Menschen frei von Zwecken zu sehen. Und gerade diese durch und durch humane Befreiung von Zwecken gehört, wie gesagt, zum Wesen der Kunst.
Ich erinnere mich wieder an die Erzählungen meines Akkordeonlehrers: Erst die völlig „zwecklose“ Musik gab den Soldaten die Freiheit zurück, einander als das zu sehen, was sie waren. (Und selbst die unüberbrückbare Entfernung zwischen der wehmütigen sibirischen Seele und dem spröden ostfriesischen Gemüt mag in diesem Moment wenn nicht verschwunden, so doch geschrumpft sein.)
Indem Menschen für freie Kunst empfänglich werden, befreien sie sich selbst von der Diktatur der Zwecke und öffnen sich für die Grunderfahrung des Menschseins, die uns alle eint. Selbst wenn die Formen, die Rezeptionsweisen und auch die Partizipationschancen sehr unterschiedlich sein können, ist diese Grunderfahrung letztlich doch universal, unabhängig von Nation, Geschlecht, Stellung und Klasse.
Wenn also Kunst das leisten soll, was nur sie leisten kann, muss sie aus der Freiheit kommen und in die Freiheit führen.
–
–
Dieser Artikel ist Teil unserer Publikation: “Vielheitsplan Kultur – rein praktisch!” Weitere Informationen finden Sie hier