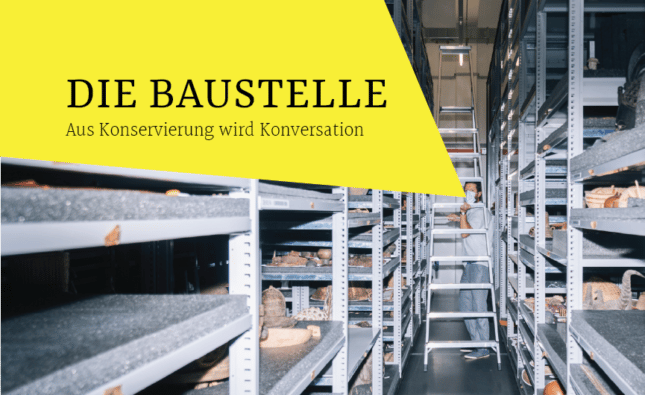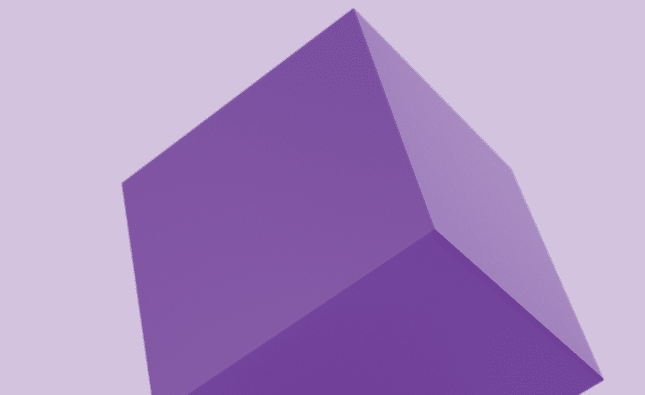von Elizaveta Khan
Zu Beginn möchte ich verschiedene Perspektiven eröffnen, nicht durch einen wissenschaftlichen oder praxisbezogenen Input, sondern durch Geschichte und Geschichten aus dem Leben.
Warum Geschichten?
Mely Kiyak sagte in ihrer Rede die folgenden Worte:
„Geschichten erzählen bedeutet ja eigentlich Menschen zu erzählen. Oder das Leben versuchen zu begreifen. Insofern fühle ich mich sehr verwöhnt, denn seit ich hören kann, hörte ich Geschichten vom Leben, Lieben und Sterben.“
Mely Kiyak
Und auch in all den Diskursen um Teilhabe und Teilnahme geht es nicht um Zahlen oder Begriffe. Es geht um Menschen und um Lebenswirklichkeiten. Daher ist Geschichte, sind Geschichten der beste Weg, in diese Diskurse einzusteigen.
Zunächst einmal möchte ich Euch Lesende einladen, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Warum?
Weil wir uns zunächst dessen bewusst werden müssen, dass „weiße Europäer_innen und Nordamerikaner_innen die Welt nicht nur militärisch und wirtschaftlich dominierten und dominieren. Sie vermittelten und vermitteln auch kulturell ihre Perspektiven/Interpretationen und Umgangsweisen, ihr Wissen und ihre Geschichten als wahr und überlegen.“ (Richter 2015, S. 227) Und sie konnten und können bestimmen, welche Lebenswirklichkeit sichtbar wird – und damit auch relevant.
Die folgende Geschichte, die sich an Kinder richtet, habe ich aus dem Buch „Gefangen in der Gesellschaft. Alltagsrassismus in Deutschland. Rassismuskritisches Denken und Handeln in der Psychologie“ von Dileta Fernandes Sequeira adaptiert.
Es war einmal…
… die Welt sehr groß, aber nicht größer als die Welt heute. Die Welt war groß, weil der Mensch sich nicht so weit fortbewegen konnte. Er konnte sich nur zu Fuß bewegen. So konnte er nicht besonders weit kommen. Deshalb blieben die Menschen dort, wo sie waren.
Dann zähmte der Mensch das Pferd, brach seinen Willen und nutze es zur Fortbewegung. So konnte er reiten und viel weiter kommen, als es zu Fuß möglich gewesen wäre. Später baute er kleine Boote und kleine Wagen ohne Motor.
Abenteuerlust hat jeder. Die Menschen bewegten sich fort – überallhin, wohin sie zu Fuß, mit ihren Pferden, Wagen oder Booten kamen.
Große Boote mit vielen Menschen am Ruder machten es möglich, dass sich die Menschen zu „neuen“ Kontinenten und neuen „Königreichen“ aufmachten. Und so kam es, dass Menschen aus Europa zu neuen Kontinenten fanden. Da es damals keine Grenzen gab und keine Pässe, sind die Europäer einfach in diese Gegenden eingereist. So kamen sie mit anderen Menschen, Tieren, Gewürzen, Stoffen, Steinen und Metallen in Kontakt. Sie trieben Handel mit diesen Menschen. Sie kauften Seide, Gewürze, Porzellan, Stoffe und Tabak. Die Europäer lernten Menschen kennen, die ganz anders aussahen und anders sprachen als sie. Die Hautfarben der Menschen nannten sie schwarz, gelb oder rot. Ihre eigene Hautfarbe nannten die Europäer weiß. Warum? Das weiß niemand wirklich genau. Denn eigentlich waren sie doch rosa gefärbt.
Irgendwann begannen sie zu denken: „Warum sollen wir diese Sachen eigentlich kaufen? – Wir nehmen sie uns einfach. Wir transportieren Menschen, damit sie woanders für uns arbeiten.“ Diese Leute nannten sie Sklaven. Viele Menschen starben, weil sie sich vor den Krankheiten der Europäer nicht schützen konnten. Damals gab es keine Impfungen. Irgendwann bekamen die Europäer ein schlechtes Gewissen. Sie waren Christen und in der Bibel stand, dass in den Augen Gottes alle Menschen gleich sind. Sie wollten die Sklaven aber weiter ausbeuten. Sie taten so, als ob es verschiedene „Menschenarten“ gäbe. Sie schrieben Bücher, in denen stand, dass eine rosafarbene Art eine bessere Art sei.
Die Roten, die Schwarzen und die Gelben, das sind die schlechteren Menschenarten, sagten sie. So dachten sie, dass sie diese Menschen und die Länder, in denen sie lebten, weiter ausbeuten dürften. Sie haben schlimme Sachen getan. Sie haben viele Menschen umgebracht. Sie haben ganze Länder ausgebeutet und kaputtgemacht.
Dann wurde der Motor erfunden. Wägen, Züge und Boote konnten sich weiter wegbewegen. Dadurch konnten die Europäer mehr zerstören, um mehr Geld für sich zu bekommen. Im 18. Jahrhundert war das Zeitalter der Aufklärung und die Demokratie entwickelte sich in Europa. Man begann, die Menschenrechte in Europa zu schützen. Die Orte, in die die Europäer eingedrungen waren, nannte man Kolonien. In ihnen wurden die Menschenrechte nicht beachtet. Die Menschen dort wurden sehr brutal behandelt.
Irgendwann war es dann nicht mehr in Ordnung, Kolonien und Sklaven zu haben. Die kolonialisierten Länder begannen, gegen die Europäer zu kämpfen. Kolonien wurden aufgelöst. Autos, Schiffe und Flugzeuge halfen Menschen, sich sehr schnell und sehr weit fortzubewegen. Die Menschen aus den kolonialisierten Ländern fingen an, sich in Richtung Europa zu bewegen. Das gefiel den Europäern nicht und sie begannen, ihre Grenzen zu schließen.
Warum habe ich diese Geschichte gewählt?
Ich finde, sie zeigt auf, wie selbstverständlich die weiße Bevölkerung ganze Kontinente gewaltsam besetzte, die Menschen vor Ort unterdrückte, versklavte und ermordete.
Und sie zeigt auf, dass die Kolonialisierung auf einer rassistischen Weltvorstellung basierte. Außerdem illustriert sie die Auswirkungen der Kolonialisierung auf das Heute. Denn die geschaffenen Fakten wirken bis in unsere Zeit fort, beispielsweise in Form von Grenzen oder dem System der wirtschaftlichen Abhängigkeit und Verschuldung von Staaten.
Und vor allem in einem Blick auf die Welt aus der weißen und eurozentrischen Perspektive. Wir können festhalten, dass die historisch etablierten Macht- und Gewaltverhältnisse das Erbe des Kolonialismus sind und dass sie bis heute fortdauern.
Das ist die Eigenschaft von Geschichte – sie ist nie abgeschlossen, sondern durchwirkt das Gestern, das Heute und das Morgen. Daher sind auch die hier nun folgenden Geschichten gültig und aktuell.
Und wenn jemand sagen sollte, das seien Einzelfälle, kann ich nur entgegnen: Sich auf Einzelfälle zu beziehen, das ist der Sinn unserer Arbeit. Es geht zwar nicht darum, jeder Person unter die Arme zu greifen; es geht bei unserer Arbeit jedoch darum, solche Strukturen und eine solche Atmosphäre zu schaffen, wo jede Person sein kann, wer sie will. Die folgenden Geschichten sind dafür repräsentativ; sie bieten überdies eine Möglichkeit, Raum für neue Perspektiven zu schaffen. Denn es sind unsere Realitäten und unsere Geschichten.
Werfen wir also einen Blick auf das Heute. Ich möchte mit Ihnen und Euch Geschichten teilen, die uns in der Praxis begegnen. Außerdem greife ich wieder auf Geschichten aus dem Buch von Dileta Fernandes Sequeira zurück.
Als ich unter der Dusche stand, bemerkte ich, dass meine Haut wieder spröde geworden war. Meine Hautärztin hatte beim letzten Gespräch gesagt: „Das liegt daran, dass Ihre Haut nicht weiß und nicht schwarz ist, das liegt an der Vermischung.“ Ich dachte mir: „Das liegt daran, dass meine Grußmutter von deutschen Soldaten vergewaltigt wurde, nachdem Generalleutnant Lothar von Trotha den Befehl gegeben hatte, die Herero und Nama vollständig zu vernichten.“ Die Geschichte des Rassismus ist mir in die Haut geschrieben.
Ich bin weiße Deutsche. Es gibt Menschen, die viel Schlimmeres erleben und dadurch traumatisiert sind. Sie sind aber mutig und haben gelernt, mit ihrer Traumatisierung zurechtzukommen. Wenn sich jemand rassistisch angegriffen fühlt, sollte er sich wehren. Es gibt nichts anderes zu tun. Ich finde, dass wir Deutsche hart gearbeitet haben, und es darf uns gut gehen. Ich reise viel und werde überall gut behandelt. Ich genieße dieses Privileg. Es gibt Länder, die viel schlimmer mit ihren Bürgern umgehen – im Vergleich geht es den Ausländern hier sehr gut. Ich weiß nicht, worüber sie sich beschweren und warum sie alles übertreiben. Rassismus ist nicht mein Problem. Uns geht es gut in Deutschland. Wir haben keinen Krieg mehr. Wir haben genug zu essen. Und trotzdem machen wir das Leben kompliziert. Muss ich alle Empfindlichkeiten akzeptieren? Manchmal ist der Verkäufer auch blöd zu mir. Außerdem bin ich mit meinem Leben sehr beschäftigt. Ich habe keine Kapazitäten, mich da zu vertiefen, mich um Rassismus zu kümmern.
Einsamkeit, Isolation, tägliche Erfahrungen von intersektionaler Diskriminierung, Gewalt und ungleiche Machtverhältnissen sind in öffentlichen und privaten Räumen gegenwärtig. Die unmittelbare Folge ist, dass sich Menschen entmenschlicht fühlen – durch mangelnden Respekt, fehlende Anerkennung und verhinderte Sichtbarkeit; dies wiederum kann sogar zu Mord und Selbsttötung führen.
Es ist furchtbar, dass wir nicht wir selbst sein und unser Leben in Frieden leben können, sondern von offiziellen Stellen beurteilt werden müssen – und dass wir deren Erlaubnis oder Zustimmung brauchen, um uns zu unseren Identitäten berechtigt zu fühlen. Es ist furchtbar, dass wir die ganze Zeit kämpfen müssen – ohne Garantie auf Erfolg. Und es ist furchtbar, dass Leiden zu unserem Alltag gehört, denn das hat kein Mensch verdient. Selbst wenn wir es schaffen, zu uns zu stehen und kleine Inseln der Sicherheit und Akzeptanz zu finden, kann dies zwar Heilung begünstigen, doch die Erfahrung von Diskriminierung wird uns unser ganzes Leben begleiten.
Und nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Nachfahren, in Form generationenübergreifender Traumata – da wir die Erfahrungen unserer Vorfahren erben.
Weißt Du Lisa, sobald ich erzähle, dass ich Jüdin bin, erklären mir alle, dass sie während der Zeit des Nationalsozialismus Jüdinnen und Juden versteckt haben. Ich denke mir dann, so viele Jüdinnen und Juden gab es gar nicht, dass ihr sie hättet alle verstecken können. Meine Familie ist mir genommen worden, meine Geschichte ist mir genommen worden, auf vielfältige Art und Weise, brutal, endgültig. Und nicht mal diese eine Geschichte, dass ich Jüdin bin, können sie mir lassen. Warum wollen die Deutschen immer alles bewältigen? Vor allem: Wie wollen sie diese Geschichte bewältigen?
Ich bin Deutsche. Schon als Kind habe ich mich für Ausländer interessiert. Ich fand sie schön, toll, interessant. Ich wollte auch eine dunkle Hautfarbe haben. Meine Mutter hat dann gesagt, dass weiße Hautfarbe besser sei, weil Menschen mit dunkler Hautfarbe es nicht so einfach hätten. Ich habe das damals nicht verstanden. Ich bin viel gereist, wurde überall gut aufgenommen und habe während meiner Aufenthalte im Ausland viele Freundschaften geschlossen. Für mich sind diese ausländischen Freunde – oft aus ehemaligen kolonialisierten Ländern – ganz normal. Ich habe sie nicht als Schwarze betrachtet. Ich bin immer gespannt, wenn ich Ausländer sehe. Ich werde neugierig und will wissen, wo sie herkommen und so weiter. Das hat für mich sofort einen positiven Effekt. Ich gehe höflich und respektvoll mit ihnen um. Dass es uns in Deutschland gut geht auf Kosten anderer, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ich habe diese Verhältnisse nicht geschaffen. Ich genieße es, dass es mir hier gut geht. Zunehmend mache ich mich aber Gedanken: Ist das alles gerecht? Was soll ich tun?
Und dann schaue ich mich um und denke: Sie haben uns geholt, die Kontingentgeflüchteten, die Aussiedler:innen, die Gastarbeiter:innen und dann wieder die Spätaussiedler:innen, dann all die geflüchteten Menschen aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Syrien, dazwischen die EU-Osterweiterung, wer schuftet denn hier die ganze Zeit? Wie ertragen wir das alles? Wie können wir dieses Land lieben?
Ich bin ein Mensch mit Migrationsvordergrund. Ich habe mein Land als wertvolle, selbstbewusste und weltoffene Akademikerin verlassen, um als wertlose Ausländerin in Deutschland anzukommen. Heute weiß ich, was damals mit mir los war. Damals wusste ich es nicht. Ich habe meine Vitalität verloren. Es waren die subtilen Erfahrungen des Ausgrenzens, das Racial Profiling, zum Beispiel am Flughafen oder am Bahnhof, und die viele täglichen Portionen des Rassismus, die mich geschwächt haben. Viele Erfahrungen, viele Gefühle, die niemand verstanden hat, die auf Widerstand gestoßen sind und heute noch auf Widerstand stoßen.
Grundsätzlich muss sich die Gesellschaft ändern, von überholten Rollenbildern ablassen und sich grundlegend strukturell anders aufstellen, damit Stimmen und Perspektiven gesehen und gehört werden können. Die ganze Gesellschaft sollte ein safer space sein. Mit unseren selbstorganisierten Räumen versuchen wir, dieses Ideal zu leben. Besonders für migrierte LSBTIAQ+ of Color ist es sehr wichtig, Anlaufstellen zu haben.
Queer zu sein, eine Person of Color zu sein und eine Migrationserfahrung durchlebt oder eine Flucht hinter sich zu haben, bedeutet eine riesige Herausforderung. In ein neues Land zu kommen, von dem du gar nichts weißt, und zu versuchen, ein neues Leben zu beginnen oder einfach nur zu überleben, weil du dein Zuhause verlassen musstest – das kann hart sein.
Was zeigen uns diese Geschichten? Warum ist es mir wichtig, sie hier zu erzählen? Es geht mir nicht darum, Studien, Konzepten, Methoden, wissenschaftlichen Praxen ihre Berechtigung zu entziehen. Aber es ist mir ein Anliegen, dass wir unsere Weltsicht reflektieren. Dass wir uns darüber im Klaren sind: Eine Weltsicht, die Geschlecht und Geschlechtsidentitäten, kulturellen Hintergrund, Hautfarbe, Ethnizität und soziale Klasse nicht berücksichtigt, kann keine realitätsnahe Weltsicht sein.
Intersektionalität ist nicht nur das Konzept sich verschränkender und gegenseitig bewirkender, miteinander und gegeneinander agierender Diskriminierungsformen. Unsere Welt ist Intersektionalität. Deshalb ist eine Weltsicht, die Geschlecht und Geschlechtsidentitäten, kulturellen Hintergrund, Hautfarbe, Ethnizität und soziale Klasse berücksichtigt, eine realistische.
Die große Challenge ist: Wie können wir diese Lebensrealitäten in produktive Veränderungskonzepte einbinden?
Wir sind nicht fürs Foto da, aber auch.
Unsere Realität als Sozialarbeiter*innen bringt uns mit Menschen zusammen, die sonst immer nur Zielgruppen sind. In der Kultur aber, verstanden als soziale Praxis der Weltdeutung, fühlen wir uns dem Menschen verbunden.
Durch Vielheit geprägte Begegnungen, im Grund also alle Begegnungen, erzeugen sowohl Empfindungen von Gleichheit als auch Gefühle der Differenz. Das Zusammendenken von Gleichheit und Differenz ist demnach auch Herausforderung. Einerseits sollen Unterschiede nicht negiert werden, andererseits muss Diversität lebbar sein. Deswegen war es uns ein Anliegen, in unserem Projekt den Mehrwert und die Relevanz gelebter Vielfalt durch einen multiperspektivischen Vielheitsplan praktisch umsetzbar zu machen. Dabei konzentrierten wir uns auf den Bereich der Kultur. Denn in der Konzentration auf kulturelle Projekte sahen und wir die Chance eines multiperspektivischen Zugangs und der für die Umsetzung notwendigen Interdisziplinarität.
Im Sinne solch eines multiperspektivischen, interdisziplinäres Anliegens beziehen wir folgende Gesichtspunkte in die Beschreibung soziokultureller Projekte ein:
- Verschiedene Ausdrucksformen (Literatur, Kunst, Musik, Tanz etc.)
- Verschiedene Berufsfelder (Regisseurin, Bühnenbildner, Schauspielerin*, Tänzer:in etc.)
- Verschiedene Mit-Zielgruppen (wie z.B. in Kinder- und Jugendprojekten)
- Verschiedenes Wissen und verschiedene Zugänge zur Welt und zur Gesellschaft
- Verschiedene Strukturen und Hierarchien in und außerhalb der durchführenden Organisationen
Wenn verschiedene Menschen – und Menschen sind immer verschieden – zusammenkommen, um etwas Gemeinsames zu gestalten, brauchen wir Wahrnehmung und Repräsentation, Interesse an- und füreinander, verschiedene Kanäle und Kommunikationsformen – sowie einen Plan. Einen Vielheitsplan. Verstanden als ein demokratisches Instrument, um Macht und Ressourcen zu teilen. Und eine Form der Kommunikation zu etablieren, die den Realitäten einer Vielheitsgesellschaft gerecht wird.
Dr. Mark Terkessidis hält in diesem Zusammenhang fest: „Die Gesellschaft benötigt Vielheitspläne, die sich an den unterschiedlichen Voraussetzungen, Hintergründen und Referenzrahmen aller Individuen orientieren.“
Dabei meint „die Gesellschaft“ uns als Personen, die mit verschiedenen Interessen versuchen, miteinander im Gespräch zu bleiben, Realitäten zu übersetzen, Wirklichkeiten zu beschreiben. Wir fragen uns daher, was unser Beitrag zu einer gerechteren und offenen Gesellschaft sein kann. Wir sind gerne mit Menschen zusammen, hören und teilen unsere Geschichten, unterstützen andere beim Zurechtkommen. Uns alle verbindet der Wunsch nach Beisammensein, Respekt, Repräsentation, Freiheit, Fairness, Frieden, Ankommen und Sinn. Und wir alle haben verschiedene Ideen, Gedanken, Fantasien, Fragen – dazu, was wir sind und was wir wollen. Wir engagieren uns für eine rassismusfreie und diversitätssensible Gesellschaft, für die Achtung der Menschenwürde. Aber wir haben in den meisten Fällen schlichtweg zu wenig Zeit. Deswegen brauchen wir einen Plan, der in die dichte zeitliche Struktur der jeweiligen Projekte passt.
Doch ein wichtiger Aspekt fehlt. Wir sind eine migrantische Organisation. Was heißt das? Das bedeutet, dass 75 Prozent unserer Teammitglieder aus einem anderen Land kommen, dass 50 Prozent eine nichtdeutsche Staatsbürgerschaft haben, dass 100 Prozent mehr als eine Sprache sprechen, dass 50 Prozent als Kinder und Jugendliche viele Zugänge und Ressourcen zur Bildung und Kultur hatten, dass 50 Prozent studiert haben, dass 80 Prozent in Armut gelebt haben, dass 90 Prozent nur befristete Verträge haben, dass eine Planung der Ressourcen fast unmöglich ist, dass die klare Haltung immer schwieriger wird – je nachdem, welche Abhängigkeiten bestehen – und dass 90 Prozent von uns die Erfahrung des Heimwehs, des Andersseins, der Verbundenheit miteinander und des Misstrauens uns gegenüber teilen.
Wir brauchen also einen Plan und eine klare Vision, was wir wollen.
Wie können wir Vielheit praktisch und vor Ort gestalten? In unserem Projekt wollten wir unterschiedliche Wege der Umsetzung eines Vielheitsplans beschreiten und beschreiben. Für das Projekt sind wir verschiedene Kooperationen mit unterschiedlichen Kulturinstitutionen und Kulturprojekten eingegangen: dem Rautenstrauch-Joest-Museum Köln, der Akademie der Künste der Welt, dem KUNTS e.V., dem Kölner Verlag parasitenpresse sowie dem Projekt „BREATHE!“ von Erasmus+ mit den Organisationen Alter Natives (Frankreich), Vision Sud Sénégal (Senegal), Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not (Österreich), InsightShare Ltd (UK) und Afropean Project (Belgien) sowie dem Projekt „Roots INTERAktion“.
Bei der Arbeit an den eigenen Strukturen wurden wir von Dr. Mark Terkessidis begleitet. Im Fokus stand hier das Konzept des Ver-Lernens und des Kennenlernens. Wichtigste Voraussetzung für eine organisationsinterne Veränderung war eine klare Kommunikation und das Einbinden der Realitäten vor Ort. Jede Person in der Organisation hat ihre Vorstellung davon, was ein guter Ort zum Arbeiten und für das Engagement ist. Zentral war es daher auch, Raum zu schaffen für diese Ideen und Bedarfe, für Kommunikation und Informationsweitergabe, aber auch für eine Akzeptanz von Grenzen und Ressourcenbeschränkungen.
Eine weitere Problematik stellten die Rahmenbedingungen dar, in denen migrantische Organisationen stecken. Der Beitrag von Dr. Mark Terkessidis fasst die Spannungen und „Gefängnisse“ zusammen, in denen wir in der Praxis verhaftet sind.
In der vorliegenden Handreichung Publikation beschreiben wir die jeweiligen Kooperationsprojekte sowie die im Zuge ihrer Durchführung entstandenen Gedankengänge. So formulieren wir unsere Erfahrungen und leiten daraus unsere Rückschlüsse ab.
Dabei haben wir Unterstützung von Alexander Estis bekommen. Alexander Estis verfasst Essays, Glossen und Kolumnen für Deutschlandfunk Kultur, Frankfurter Rundschau, Neues Deutschland, Berner Zeitung, die Unabhängige Zeitung Moskau u.a. Einen Schwerpunkt seiner kolumnistischen und essayistischen Arbeit bilden Kulturpolitik und Kulturbetrieb.
Unsere Hoffnung ist es, aus der Praxis zu lernen, Einblicke in die Arbeit vor Ort zu geben und Handlungsoptionen für andere Einrichtungen zu entwickeln.
Sprache und Begriffe
Die Schreibenden lieben die deutsche Sprache. Es fällt uns nicht schwer, uns zu artikulieren. Die deutsche Sprache ist aber nicht unsere Muttersprache und zu unseren Biografien gehörte das Deutschlernen wie auch das Deutschlehren. Deswegen wissen wir um die Macht der Sprache. Und wir haben die Erfahrung, dass Schreiben mit komplizierten Worten und Sätzen Sachverhalte gut zusammenfassen kann. Oft aber so, dass Lesende den Gedankengängen nicht gut folgen können. Deswegen haben wir verschiedene Formen der Dokumentation gewählt, um unsere Gedanken nachvollziehbar zu machen.
Feste Begriffe sind einerseits eine Möglichkeit, die diverse Realität auf den Punkt zu bringen, andererseits werden gerade Menschen mit festen Begriffen mehr schlecht als recht abgebildet. Daher nehmen wir uns die Zeit und so viele Wörter wie nötig, um zu beschreiben, was wir beobachtet haben und wer in die Prozesse eingebunden war.
Was war los im Projekt?
Mit dem Rautenstrauch-Joest Museum Köln arbeiteten wir im Rahmen der Ausstellung „Resist! Die Kunst des Widerstands“ zusammen. Die folgenden Fragen haben wir dabei diskutiert: Wie kann eine Zusammenarbeit der Institution „Museum“ mit migrantischen Organisationen gestaltet werden? Wie können sich Initiativen in Institutionen einbringen?
Mit der Akademie der Künste der Welt kooperierten wir im Rahmen von deren „partizipativem Stipendienprogramm“. Der folgenden Frage sind wir dabei nachgegangen: Wie können Ideen von migrantischen Organisationen in etablierte Strukturen wie beispielsweise Stipendiatenprogramme eingebracht werden? Und wir haben zusammen die Bundesmigratin:innenwahl mit dem Netzwerk „Die Vielen NRW“ organisiert.
Gemeinsam mit dem KUNTS e.V. und dem Verlag parasitenpresse führten wir das Europäische Literaturfestival Köln-Kalk durch und begleiteten dieses mit Evaluationsfragen: Wie kann Projektarbeit mit unterschiedlichen Akteur:innen und unterschiedlichen Zugängen zu Kunst gestaltet werden? Wie wird Vielfalt nicht nur „plakativ“, sondern auch strukturell einbezogen und abgebildet?
Im Rahmen des Projekts „BREATHE!“ von Erasmus+ arbeiten wir mit Organisationen aus Frankreich, Belgien, Großbritannien, Österreich und dem Senegal zusammen. Wir wollen verstehen: Wie können Projekte auf europäischer Ebene durch Neue Deutsche Organisationen mitgestaltet werden? Wie sehen Zugänge zu europaweiten Projekten für migrantische Organisationen aus? Im Sommer haben wir dazu eine Kundgebung mit einer Theaterperformance initiiert. Mit „Back to Benin City“ haben wir uns zu den Restitutionsforderungen positioniert und den zivilgesellschaftlichen Stimmen einen Raum gegeben.
Mit „Roots INTERAktion“ haben wir die Theater-Performance ROOTS! In öffentlichen Räumen auf die Bühne gebracht. Im Anschluss an die Theateraufführungen hat sich das Ensemble und die künstlerische Leitung sowie Engagierte aus der Zivilgesellschaft mit den Zuschauer:innen über die Performance und das Projektthema „struktureller Rassismus“ ausgetauscht. Damit wurde ein interaktives Format geschaffen, bei dem Menschen die Möglichkeit hatten, sich unabhängig ihres sozialen Status und ihrer kulturellen Identität in öffentlichen Räumen in Köln im Rahmen der Präsenzveranstaltung zu begegnen.
–
Dieser Artikel ist Teil unserer Publikation: “Vielheitsplan Kultur – rein praktisch!” Weitere Informationen finden Sie hier