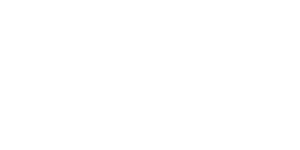von Dr. Mark Terkessidis
Die Vereine, Einrichtungen und Projekte von und für Personen mit Migrationshintergrund oder BPOC waren und sind eine hybride Angelegenheit. Sie pendeln zwischen Selbsthilfe, zivilgesellschaftlichem Engagement und der freien Trägerschaft von im weitesten Sinne sozialarbeiterischen Tätigkeiten (Jugendhilfe, Beratung, Integrationsangebote etc.). In ihren Aktivitäten sind diese Organisationen unentwegt konfrontiert mit gänzlich anderen Einrichtungen, deutlich größeren Organisationen eines bürokratischen Typs wie vor allem Behörden, aber auch Bildungs- und Kultureinrichtungen. Diese größeren Organisationen sind gewöhnlich Teil des Staates oder staatlich finanziert. Die Zusammenarbeit sorgt für eine erhebliche Reibungsfläche, die sich aus der Unterschiedlichkeit der Einrichtungen und auch aus dem gewöhnlich auftretenden Machtgefälle ergibt. Die Frage ist, wie diese Reibungsfläche zu verringern wäre in einer demokratischen Gesellschaft, in der ja alle Organisationen für die Durchsetzung von rechts- und sozialstaatlichen Prinzipien stehen sollen.
Eigentlich müssten die genannten Akteure an einem Strang ziehen. Dem Selbstverständnis nach engagieren sich etwa die 130 Einrichtungen unter dem Dach des Netzwerkes der „Neuen Deutschen Organisationen“ für „mehr Sichtbarkeit, Teilhabe und Chancengerechtigkeit“. Hier werden also die rechtsstaatlichen Gleichheits- und Gleichbehandlungsgebote eingefordert, für deren Gewährleistung die Behörden oder Bildungs- und Kultureinrichtungen per se zuständig sind. In der Realität allerdings erweist sich der institutionelle Bereich teilweise als problematisch: In den letzten Jahren wurde medienwirksam diskutiert, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder BPoC in Ämtern, Theatern oder Schulen teilweise institutionell, teilweise individuell diskriminiert werden. Daher wären die „neuen“ Organisationen ein wichtiges Korrektiv. Doch sie können in ihrem Einsatz gegen Diskriminierung zurzeit kaum effektiv sein. Sie fungieren gewöhnlich als Auftragnehmer:innen zumal der Ämter und werden angesichts der Geldzuwendungen von diesen als Einrichtungen betrachtet, die für die speziellen Bedürfnisse der sogenannten Zielgruppe zuständig sind und eben nicht für „Chancengerechtigkeit“ im Allgemeinen.
Diese Sichtweise verhindert, dass die Selbstorganisationen ihre eigentliche Rolle erfüllen können. Das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass der Staat die Selbsthilfe seiner Bürger:innen wertschätzen und unterstützen soll – ohne selbst beeinflussend oder konkurrierend einzugreifen. In den letzten Jahrzehnten ist dieses Prinzip aber systematisch ausgehöhlt worden: Die freien Träger:innen – seien es die großen wie Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt, der Paritätische als Dachorganisationen oder die Myriaden von kleinen Organisationen – sind immer mehr zu Dienstleistern für die staatlichen Stellen geworden, die zudem miteinander im Wettbewerb stehen. Über die Tätigkeiten wird eine starke Kontrolle ausgeübt – durch ausufernde Abrechnungs- und Berichtsmodalitäten, Wirkungsmessungen oder fremdgesteuerte Evaluationen. Der Mangel an Unabhängigkeit macht es sehr schwierig für die stark wertorientierten, „neuen“ Organisationen, ihre Werte tatsächlich zu leben und im Hinblick auf Diskriminierung als Korrektiv für die staatlichen Institutionen zu wirken. Der partnerschaftliche Aspekt der Subsidiarität und die Vertiefung und Weiterentwicklung der demokratischen Rechte sind blockiert.
In der konkreten Zusammenarbeit stehen sich darüber hinaus zwei Organisationslogiken gegenüber, die die US-Psychologen Daniel Katz und Robert Kahn in ihrer klassischen Social Psychology of Organizations als „expressiv“ und „instrumentell“ bezeichnet haben. In den expressiven Aktivitäten, die sich maßgeblich in den „neuen“ Organisationen finden, beziehen die Mitarbeitenden die Belohnung für ihre Arbeit weniger aus der (ohnehin zumeist schlechten) Bezahlung, sondern vielmehr durch die Tätigkeit selbst, in der sich die Werte ihrer Organisation und die eigenen Werte verkörpern. Obwohl die Arbeit zeitlich ausufernd und oft auch psychisch belastend ist, bleiben die Personen hochgradig motiviert, weil sie Menschen in schwierigen Lebensumständen helfen und zugleich auch für deren bessere Repräsentation sorgen. Gleichzeitig werden die Einrichtungen der „Selbsthilfe“ selbst zu „anderen“ Orten, zu Willkommensräumen, in denen die demokratischen Rechte durch Austausch, Vernetzung oder Unterstützung der individuellen Entfaltung konkret gelebt werden.
Die Behörden, Bildungs- und Kultureinrichtungen (wobei die Letztgenannten ja abgesehen vom künstlerischen Bereich in der Kultur ebenfalls behördlich organisiert sind) werden dagegen überwiegend von instrumentellen Motiven gesteuert. Zweifellos gibt es auch hier idealistische Personen, die an Veränderung mitwirken, doch mehrheitlich werden die Leistungen bestimmt durch den Wunsch nach Jobsicherheit, geregelten Arbeitszeiten und Einkommen. Die Tätigkeiten zielen entsprechend auf die Befolgung von Regeln und die Herstellung von Berechenbarkeit. Die „Klienten“ spielen per se nicht die wichtigste Rolle, denn deren Sanktionierungsmacht ist gering. Höchste Relevanz hat die Vermeidung von Fehlern, denn solche Fehler können interne Sanktionen nach sich ziehen, zumal was die Position innerhalb der Behörde betrifft. In diesem Sinne ist auch klar, dass Innovation in diesen Strukturen schwer zu gestalten ist.
Die instrumentelle, primär nach innen gerichtete Orientierung vieler Mitarbeitender in Behörden, Bildungs- und Kulturinstitutionen bringt es quasi von selbst mit sich, dass der Personenkreis, der von „neuen“ Organisationen vertreten wird, hauptsächlich als Objekt angesehen wird, als Objekt von Maßnahmen zur „Integration“. Die deutschen staatlichen oder staatsnahen Einrichtungen arbeiten seit jeher mit äußerst normativen Vorstellungen: Es gibt eine starke Idee von der „normalen“ Klientel, die die richtigen Voraussetzungen mitbringt, das richtige Benehmen, das nötige Vorwissen, die korrekten Unterstützungsmöglichkeiten, die adäquate Kunstvorstellung – alle anderen erscheinen als Abweichungen, die einer Sonderbehandlung bedürfen und somit zum Gegenstand aller möglichen Maßnahmen werden. Der Bias zugunsten des akademischen Mittelstandes deutscher Herkunft ist überall spürbar.
Um auf die eingangs formulierte Frage zurückzukommen: Wie wäre die Reibungsfläche zu verringern? Tatsächlich erscheint das nicht leicht, weil es kaum Problemeinsicht gibt. Für die „neuen“ Organisationen ist zwar klar, dass sie unter Abhängigkeit, Wettbewerbsdruck, Ressourcenknappheit, Zeitnot und einem Mangel an Struktur leiden, aber das Problem wird selten auf der politischen Ebene angegangen. Tatsächlich ist es schwierig, zusammen mit anderen Wettbewerbern wie etwa den Wohlfahrtsverbänden eine politische Front aufzubauen, da in Sachen Fördergelder sozusagen niemand die Hand beißen möchte, die einen füttert. Über das Problem auf politischer Ebene zu sprechen, bliebe allerding primäres Ziel. Das Subsidiaritätsprinzip braucht eine Neudefinition – die Organisationen der Selbsthilfe sollten mehr Unabhängigkeit haben und der Kontakt mit den Behörden sollte partnerschaftlich gestaltet werden.
Eine solche Neudefinition würde die Grundlage für eine Veränderung der Haltung in den behördlichen Strukturen bilden. Die derzeitige Sichtweise, die Personen mit Migrationshintergrund und BPoC (zumal wenn sie formal Ausländer:innen sind) häufig zu Objekten macht, kollidiert ja immer öfter mit der Wirklichkeit. Die verzerrte Wahrnehmung verursacht Störungen in den Arbeitsabläufen sowie Diskriminierung. Die Kollaboration mit den „neuen“ Organisationen würde ein besseres Wissen über die Bevölkerung und die unterschiedlichen Voraussetzungen, Hintergründe und Referenzrahmen der Individuen ermöglichen und damit auch quasi technisch ein besseres Arbeiten bedeuten. Es wäre also ganz im Eigeninteresse der Institutionen, sich auf die Zukunft hin neu auszurichten. Und wenn wir eins über die bald maßgebliche Generation der sogenannten Millenials wissen, dann Folgendes: Sie haben wenig Bereitschaft, sich in sinnlosen Arbeitsroutinen aufzureiben, und sie verachten Diskriminierung.
–
Dieser Artikel ist Teil unserer Publikation: “Vielheitsplan Kultur – rein praktisch!” Weitere Informationen finden Sie hier