Rassismuskritisches Handeln ist ein Lernprozess, der voraussetzt, die eigene Denk- und Handlungsmuster kritisch zu hinterfragen und zu verändern, um Ausschlüsse zu verhindern.
„Rassismuskritische Arbeit folgt keinem „Rezept“, das eine einfache Unterscheidung zwischen „richtig“ und „falsch“ erlaubt. Weil Menschen unterschiedlich von Rassismus betroffen sind, bedeutet Rassismuskritik außerdem nicht für alle das Gleiche“ (Bönkost, 2016: S. 98).
Wir verstehen Rassismuskritik als:
- ein solidarisches Vorgehen,
- ein Engagement gegen Ausgrenzung gegenüber marginalisierten Gruppen und gegen das Ausspielen von Sozialstaat gegenüber Geflüchteten und Migrant:innen,
- einen Einsatz zur Schaffung von Räumen zur Selbstreflexion, zur Wissenserweiterung,
- Aufklärungsarbeit hinsichtlich der Zusammenhänge institutionell verankerter rassistischer Strukturen,
- Orientierung an Menschenrechten und das Handeln für Menschenrechte.
Was sind Privilegien? Privilegien sind z.B. einen deutschen Pass haben, heterosexuell, weiß positioniert, christlich, körperlich befähigt, cis-geschlechtlich, bürgerlich sein etc… Privilegien sind für jene, die sie genießen, unsichtbar. Das System der Privilegien ist allerdings komplex.
„Das Gegenteil von privilegiert ist nicht automatisch de-privilegiert, sondern oft weniger privilegiert. Zudem wirkt Privilegierung durch Rassismus intersektional, d.h. gleichzeitig verwoben mit anderen Verhältnissen wie Kapitalismus, Geschlechterverhältnis, Heteronormativität… Eine weiße Sozialarbeiterin teilt mit Adressat*innen of Color möglicherweise die Erfahrung von Depriveligierung durch Sexismus im Geschlechterverhältnis. Gleichzeitig ist sie bezogen auf Rassismus privilegiert. Es geht nicht darum, ob Privilegien moralisch gut oder schlecht, verdient oder unverdient sind. Nicht die Individuen mit mehr oder weniger Privilegien sind das Problem, sondern die gesellschaftlichen Strukturen, die Privilegien für Weiße mit sich bringen. Sie geht mit Deprivilegierung, Ausbeutung sowie Othering- und Gewalterfahrungen Schwarzer Menschen und People of Color einher“
(Linnemann / Ronacher, 2018: S. 95)
Prinzip I: Rassismuskritik ist ein nie aufhörender Prozess der Reflektion
Die Grundlagen Sozialer Arbeit – Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit – bedingen den Einsatz für die Interessen der von Rassismus, Diskriminierung und sozialer Benachteiligung Betroffener. Diese Grundlage bildet auch die Basis in den Interkulturellen Zentren der Stadt Köln: das aktive Eintreten für eine menschenwürdige Gesellschaft. Auch wenn rechtliche Rahmenbedingungen sich nur durch langwierigen und stetigen Einsatz ändern, kann in einer konkreten Situation Solidarität erzeugt werden, indem die eigene klare Haltung deutlich aufgezeigt wird. Das allein kann in einer Situation viel bewirken und allen Beteiligten den Rücken stärken.
„[D)ie Auseinandersetzung mit Benachteiligung und struktureller Diskriminierung [ist] ein lebenslanger Prozess (…) und kein einmaliges Ereignis“ (Czollek / Perko, 2017: S. 136).
Rassismuskritische und migrationssensible Angebote initiieren, bestehende Angebote unter die Lupe nehmen, und sich auf den Prozess einlassen, innere und äußere Widersprüche und Widerstände zu thematisieren, diese auszuhalten und konstruktiv aufzulösen – das ist harte Arbeit, und ein Prozess, der niemals abgeschlossen ist: Rassismuskritik bedeutet seitens weißer Personen in besonderem Maße andauernde Selbstkritik und Reflexion. Gefühle wie Wut, Schuld und Scham können immer wieder auftreten. Doch je mehr wir unsere Verunsicherung und unser Unwohlsein verstehen und aushalten lernen, desto einfacher wird es uns fallen, uns trotz bzw. in diesem Unbehagen wohl zu fühlen und zuversichtlich gegen Rassismus einzutreten, anstatt permanent daran zu arbeiten „nicht rassistisch zu sein“ (Bönkost, 2017).
Das Lernen über Rassismus kann seitens weißer Personen Unbehagen hervorrufen. Die Erkenntnis des eigenen weiß-Seins bzw. eigener weißer Privilegien können Schuld- und Schamgefühle auslösen. Diese Gefühle können Lernprozesse blockieren oder verhindern. Sie sind nicht selten mit dafür verantwortlich, dass das Lernen über Rassismus abgebrochen wird oder es in Seminaren zu einer angespannten Atmosphäre oder heftigen Gefühlsausbrüchen kommt. Sie verhindern eine kritische (Selbst-)Reflexion und damit auch eine Auseinandersetzung mit den eigenen weißen Emotionen. Rassismuskritische Lernprozesse werden so erschwert bzw. blockiert (vgl. Bönkost, 2017: S. 2f.).
„Das Lernen über Rassismus stellt Gewissheiten infrage. Deshalb ist es normal, dass es emotionale Reaktionen hervorruft. Kritisch reflektiert können die Gefühle einen Ausgangspunkt darstellen herauszufinden, was Rassismus sowie die Kritik an ihm für die jeweiligen Teilnehmenden selbst bedeutet. Für weiße Lernende bedeutet das, sich weniger mit „den Anderen“ zu beschäftigen und mehr mit der Frage auseinanderzusetzen, wie es möglich ist, an sich selbst zu arbeiten. Verunsicherungen sind kein Störfaktor, sondern ein wesentlicher Bestandteil solcher Bildungsprozesse“ (Bönkost, 2017: S. 3).
Unterschiedliche Wissensbestände müssen kein Problem sein, wenn die grundsätzliche Bereitschaft zum gemeinsamen Lernen, Reflektieren und der Wunsch nach persönlicher und institutioneller Weiterentwicklung bestehen. Voraussetzung dafür sind zum einen die Strukturen der Einrichtung, d. h. ein Leitungsteam kann neben Lernprozessen im Plenum auch das Arbeiten in getrennten Räumen anbieten und somit den unterschiedlichen Kenntnissen, Reflexionserfahrungen und den differenten gesellschaftlichen Positioniertheiten gerecht werden.

Prinzip II: (Weiße) Rassismuskritik ist widersprüchlich
„[…] um Diskriminierung zu belegen, müssen Kategorien der Ausgrenzung benannt werden“ (Emcke, 2019). Rassismuskritik ist immer widersprüchlich. Das ist vergleichsweise einfach aufzuzeigen, weil sich irgendwo notwendigerweise immer Reproduktionen finden. Denn mit der Problematisierung rassistischer Ausschließungspraxen werden für Rassismus konstitutive Gruppenkonstruktionen und Differenzlinien immer auch bestätigt. „Wer sich wehrt gegen Ungleichbehandlung oder Ausgrenzung, muss notgedrungen oft in Kategorien argumentieren, die selbst erst durch die Ausgrenzung entstanden sind“ (Emcke, 2019). Beispielsweise ermöglichen Angebote nur für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, geschützte Räume, die „empowernde“ Prozesse der Selbstermächtigung einleiten können. Gleichzeitig wiederholen sie aber eine Einteilung von Menschen nach rassismusrelevanten
Zugehörigkeiten.
Aus diesen Widersprüchen kommen wir weder in der Praxis noch in der Theorie heraus. Und deswegen muss die Frage, ob oder wie geschützte Räume ermöglicht werden, denen überlassen werden, die diese Räume in Anspruch nehmen möchten.
Die Forderung an Einrichtungen besteht darin, die vorhandenen Ressourcen zu öffnen und nutzbar zu machen und zu kommunizieren, dass die jeweilige Einrichtung sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat und für den Bedarf und den Nutzen von bspw. geschützten Räumen sensibilisiert ist.
Prinzip III: (Getrennte) Räume des Austauschs schaffen Entlastung
Wenn Schwarze Menschen, People of Color und Indigenous People über ihre Erfahrungen mit Rassismus berichten, erhalten sie zwar häufig Aufmerksamkeit und Unterstützung, gleichzeitig stoßen sie jedoch auch oft auf Ablehnung oder ihre Berichte werden in Zweifel gezogen. Auch in Workshops zum Thema Rassismuskritik wird immer wieder kontrovers diskutiert, ob es sich bei den Erfahrungen um Rassismus handelt. Die Soziologin Robin DiAngelo forscht seit Jahren zu dieser Frage. Sie arbeitet in den USA und beobachtet in Workshops mit Weißen zum Thema Rassismus immer wieder dieselben Reaktionen. Diesem Handlungsmuster hat sie den Begriff white fragility (weiße Zerbrechlichkeit) gegeben. „Wir Weiße sind es nicht gewohnt, mit unserem Rassismus konfrontiert zu werden. Also reagieren wir auf eine Art, die den rassistischen Status quo aufrechterhält. Denn unsere Ablehnung führt dazu, dass people of color aufhören, uns ihre rassistischen Erfahrungen mitzuteilen, weil sie befürchten, dafür angegriffen zu werden. Es kann sein, dass Weiße nicht absichtlich oder bewusst so ablehnend reagieren, aber das ist das Ergebnis“ (Interview mit Robin di Angelo in der Zeit, 2018).
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Lernen in gemischten Räumen häufig ein Lernen auf Kosten der Schwarzen Menschen, Indigenous People und People of Colour bedeutet oder von Widerständen weißer Personen geprägt ist, die wiederum Verletzungen der Betroffenen mit sich bringen können. Deshalb plädieren wir in Fortbildungen, aber auch Teamsitzungen, Supervision etc. teilweise für getrennte Räume, in denen Themen aus den unterschiedlichen Perspektiven der Teilnehmenden besprochen und bearbeitet werden können.
„Seminare zur Rassismuskritik ohne Segregation haben die Tendenz, den Unterschied zwischen Teilnehmenden, die von Rassismus betroffen sind und solchen, die nicht betroffen sind, zu nivellieren. In nicht-segregierten Settings besteht die häufig nicht lösbare Herausforderung immer wieder transparent zu machen, an welches Teilpublikum sich ein Text oder mitunter eine einfache, kleine Rückmeldung richtet. Die Behauptung, alle Lernmaterialien und Inhalte seien für alle Teilnehmenden interessant, bestärkt die entnannte weiße Norm/Unmarkiertheit des Weißseins und den falschen Universalismus, auf den sich weiße Dominanz gründet“ (Boger/Simon, 2016: S. 2).
Nina Simon und Mai Anh Boger haben ein Konzept zur rassismuskritischen Arbeit für die (universitäre) Lehre entwickelt, das mit einem Wechsel durch Segregation und Des-egration arbeitet: Ziel ist es, sowohl den Gegenstand Rassismus als gemeinsamen Gegenstand und gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe zu verstehen, als auch das Differente, das von der Position in der Gesellschaft abhängt, anzuerkennen ohne es zu nivellieren (vgl. ebd. 5ff.). Beide Gruppen erarbeiten gemeinsam die theoretischen und fachlichen Grundlagen von Rassismus. Anschließend arbeiten sie in getrennten Räumen zu Empowerment und Critical Whiteness und reflektieren ihre eigene Positioniert- und Involviertheit. Abschließend treffen sich die Gruppen wieder, spiegeln sich ihre Lernergebnisse und beleuchten Rassismus als gemeinsamen Gegenstand von differenten Perspektiven. Ziel ist hier die gemeinsame Reflexion darüber, was aus der jeweiligen Position gegen Rassismus getan werden kann. Im Vordergrund steht also die Handlungsfähigkeit.
Die Erfahrung getrennter Räume kann also stärkend sein, weil unterschiedliche Erlebnisse nicht mehr unter dem Teppich bleiben müssen, sie ernst genommen werden und ihnen endlich ein Name gegeben wird. Empowerment ist ein wichtiges Element. Das Bildungsteam Berlin Brandenburg empfiehlt zur Trennung: Eine Teilung der Gruppe an der color-line, an der Grenze, die rassistische Ideologien zwischen Menschen geschaffen haben, ist nicht banal. Tatsächlich gibt es viel Unsicherheit, wenig Erfahrung und keine einfachen Lösungen. Es gilt daher, die Schaffung von Empowermenträumen in der Praxis achtsam weiterzuentwickeln und mit Kolleg:innen zu reflektieren. Das Kriterium, nach dem Empowermenträume im Kontext Rassismus gestaltet werden, sind Erfahrungen mit Rassismus. Zum einen kommt es darauf an, dass die Teilnehmenden sich selbst zu der Gruppe der negativ von Rassismus Betroffenen oder der Gruppe derer, die von Rassismus Vorteile haben, zuordnen, denn Fremdzuschreibungen durch die Teamenden sind tabu. Für diese Selbsteinordnung ist es hilfreich, wenn sie über entsprechende Kriterien verfügen, die sich aus der Beschäftigung mit der Definition von Rassismus sowie den entsprechenden gesellschaftlichen Machtverhältnissen ergeben. Dies soll verhindern, dass alle sonst erlebten negativen Erfahrungen wie z.B. Mobbing, Beleidigungen oder andere Diskriminierungsformen wie Sexismus mit Rassismus in einen Topf geworfen werden (vgl. Bildungsteam Berlin-Brandenburg, 2018).
Es ist herausfordernd, aber auch spannend, einen solchen geplanten Prozess zusammen – getrennt -gemeinsam (Boger) aus der Bildungsarbeit heraus für die Einrichtungspraxis zu konzipieren und umzusetzen. Solange dies nicht möglich ist (aus Zeit-, Kosten- oder anderen Gründen) bleibt die Gewissheit, dass in gemischten Räumen ein hoher Grad an Selbstreflexivität vorhanden sein sollte, in denen dennoch beiläufig – wenn auch ungewollt – rassistische Reproduktionen geschehen können, die andere Menschen verletzen. Oder sich im Extremfall weiße Menschen aufgrund der Angst, etwas Falsches zu sagen, nicht mehr äußern. Dieses Dilemma kann nicht komplett aufgelöst werden, das Bewusstsein darüber kann jedoch helfen, Lernräume zu schaffen, in denen alle Beteiligten wirklich lernen können – und nicht auf Kosten der anderen. Ziel sollte es immer sein, möglichst diskriminierungsfreie oder zumindest diskiminierungsärmere Räume zu schaffen.
Prinzip IV: Austauschräume für weiß positionierte Kolleg:innen sind Lernräume – und kein Selbstzweck!
“As whites, we have our own power to intervene in other white people’s actions and sometimes attitudes, which is a different power from the strength of those who organize or act against oppressions of themselves. We can often be heard, on the topic of racism, where a person of color couldn‘t be. […] Others can’t rationalize away the information with the explanation ‚she is just oversensitive‘ when an ally is speaking up about an experience which doesn’t directly target her“ (Lester, 1987).
Was bedeutet es, in unseren Strukturen mit der eigenen weißen Positionierung zu leben, zu arbeiten, zu sprechen etc.? Wie können sich weiß positionierte Pädagog:innen kontinuierlich mit ihren Privilegien auseinandersetzen, diese teilen, sich solidarisch zeigen und so zu mehr Gerechtigkeit beitragen? Wie können sie Bündnisse schließen und Bündnispartner:innen sein? Diese und noch viel mehr Fragen viele Fachkräfte. „Es ist die Aufgabe von Weißen*, Rassismus zu überwinden, denn sie sind seine Protagonist*innen und die ultimativen Profiteur*innen des Rassismus als Gesellschaftsstruktur“ (Tißberger, 2020: S. 96).
Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Weißsein geht also über einzelne antirassistische Aktivitäten hinaus. Es gibt keine „Komfortzone“ mehr. Genauso wie alle rassistisch markierten Menschen, die jederzeit wahrnehmen, wo sie offensichtlich oder subtil ausgeschlossen und „verändert“ werden, müssen auch diejenigen, die im Rassismus bisher de-markiert waren – die als neutral galten – wahrnehmen, in welcher Weise sie durch ihr Weißsein* ermächtigt und Nicht-Weiße* diskriminiert werden (vgl. ebd.) Machtverhältnisse werden von denjenigen, die von ihnen profitieren, gerne ausgeblendet. Erst wenn diejenigen, die im Rassismus de-markiert sind, ihr Weißsein* als Markierung wahrnehmen, können sie ein Bewusstsein für dessen Bedeutung und damit die Voraussetzung für Handlungsfähigkeit entwickeln – vorausgesetzt natürlich, sie wollen das überhaupt. Nach Bell hooks muss Ziel dieser Lernräume sein: „to become comfortable with being uncomfortable.“
Prinzip V: Verbündetsein und Allyship als Ziele von Austauschräumen
Ein politisches Verständnis Sozialer Arbeit sollte ein Verbündet-Sein mit den Menschen, mit denen wir arbeiten und für die wir uns einsetzen, mit sich bringen. Dies bedeutet, auch einen diskriminierungs- und rassismuskritischen Blick auf den individuellen, institutionellen und strukturellen Umgang mit diesen Menschen zu werfen und sich theoretische Grundlagen anzueignen, um unser Handeln argumentativ untermauern zu können. Grundsätzlich ist die Arbeit in Bündnissen, runden Tischen, Arbeitskreisen etc. in diesem Kontext einerseits nicht neu, andererseits sind viele Bündnisse eher als strategische Partnerschaften zu bezeichnen, die nicht wirklich mit Leben gefüllt sind. Auch stehen einem Bündnis nicht selten die Interessen, die gewohnten Denkweisen und etablierten Wahrnehmungsstrukturen der einzelnen Akteur:innen entgegen.
Gerade im Umgang mit Diskriminierung müssen Bündnispartner:innen ihre Art des Bündnisses jedoch reflektieren, um nicht gesellschaftlich vorhandene Machtverhältnisse zu reproduzieren und damit den eigentlichen Sinn des Bündnisses zu konterkarieren. Die Arbeit gegen Rassismus ist keine Aufgabe, die delegiert werden kann – Aktivist:innentum und pädagogische Arbeit in diesem Kontext schließen sich also nicht aus. Es reicht nicht aus, gegen Rassismus zu sein, um arbeitsfähige Bündnisse zu etablieren. Eigentlich sollte als Grundlage erst einmal geklärt werden, was wir unter Diskriminierung und Rassismus verstehen und wie wir uns dazu positionieren – auch intersektional. Welchen Standpunkt nehmen wir ein? Sind wir tatsächlich alle für die gleiche Sache? Das geschieht häufig nicht und plötzlich entstehen irritierende Situationen, in denen Rassismus reproduziert wird.
„Verbündet-Sein setzt die Reflexion eigener Privilegien, ein kritisches Bewusstsein für eigene Gruppenzugehörigkeiten und Identitäten sowie ein Wissen um die strukturellen Dimensionen von Diskriminierungsformen voraus. Sprechend und handelnd übernehmen Verbündete Verantwortung dafür, Diskriminierungsstrukturen und -mechanismen zu thematisieren und zu unterbrechen und öffnen dadurch Räume, in denen die je diskriminierten Perspektiven (wie queere, jüdische, migrantische oder Arbeiter_innen-Perspektiven) sichtbar werden können“ (Czollek u.a., 2019: S. 442).
Weißes Verbündetsein bringt einige Herausforderungen mit sich. In vielen vorwiegend weiß positionierten Organisationen fehlt es an rassismuskritischer und diskriminierungskritischer Expertise, aber auch an anderen Perspektiven auf dieses Thema. Durch die Bündnisarbeit mit anderen Akteur*innen können sie sich diese Perspektiven quasi hineinholen – natürlich in der Hoffnung und dem angestrebten Ziel, dass sich dadurch auch langfristig eigene Organisationen und Fachbereiche diskriminierungskritisch öffnen. Gleichzeitig ist es wichtig, deutlich zu machen, dass es für eine rassismuskritische Arbeit nicht unbedingt die Anwesenheit von Schwarzen Menschen, Indigenous People und People of Color (BIPoC) brauchen, denn in diesem Kontext entsteht durch die fehlende Repräsentanz häufg ein weiteres Dilemma: Wir brauchen einerseits die Abbildung von Diversität und gleichzeitig sollten Menschen, Fachkräfte, Referent*innen nicht wegen ihres Aussehens oder einer vermeintlichen Zugehörigkeit angefragt werden. Die Gefahr des Tokenismus („Symbolpolitik“) in verschiedenen Kontexten, z.B. als Frau in einer männerdominierten Organisation zu arbeiten oder als PoC-Fachkraft in einer weiß dominierten Organisation, muss ebenfalls im Blick sein und reflektiert werden.
Prinzip VI: Streiten gehört dazu!
Ob wir Ambiguität zulassen, hat auch damit zu tun, ob wir freies Denken zulassen. Mit „freiem Denken“ sind keine Hassreden, Beleidigungen oder diskriminierende Haltungen gemeint, sondern ein Raum, in dem nicht ständig ge- und verurteilt wird, wenn eine legitime konträre Haltung vertreten wird. Die Entwicklung von Streitkultur(en), in Einrichtungen (Mafalaani, Terkessidis) könnte hier ein erster Ansatz sein. Dazu gehört es, sich auch in Einrichtungen mit normativen Differenzen und Konflikten, aber auch mit gesellschaftlichen Diskursen auseinanderzusetzen.
Streitkultur bedeutet nicht die Einladung, sich innerhalb eines Raumes beliebig sexistisch, rassistisch, antisemitisch, queerfeindlich oder homofeindlich zu äußern. Allerdings muss der Dialog über widersprüchliche Meinungen wieder offener geführt werden. Die Gefahr in der aktuellen Debatte ist, sehr schnell Menschen auszuschließen oder als Rassisten zu etikettieren, die sich dem Thema bislang einfach nicht so intensiv angenähert haben. Um Bündnisse in einer Gesellschaft zu schließen, sind jedoch auch heterogene Gruppen wichtig. Wie können wir unterschiedliche Angehörige einer Gesellschaft, die unterschiedliche Zugänge aber zum Beispiel auch einen unterschiedlichen Bildungstand haben, zusammenbringen? Dies fällt schwerer, je größer die sozialen und gesellschaftlichen Fragen tatsächlich sind: Welche Fragen können wir erheben, die große Interessen von vielen Gruppen zusammenbringen – und nicht nur diese partikularistische und sehr individuellen Interessen repräsentieren? Um die Fettnäpfchen zu überwinden, ist eine Fehlerfreundlichkeit sicherlich hilfreich.
Prinzip VII: Allianzen bilden, Macht teilen
Angelehnt an das „Verbündet-Sein im Konzept ‚Social Justice und diskriminierungskritische Diversität‘ soll das nächste hier vorgestellte Prinzip handlungsleitend sowohl für Weiße als auch für BPoC* und für von beiden gemeinsam gestalteten Räume, Projekte und Veranstaltungen sein. Zentral für das oben genannte Konzept ist die „(…) politische Freundschaft, wo die Anliegen der Anderen die je eigenen Anliegen sind. Dabei ist kein identitäres Wir und gemeinsame (identitätsrelevante) Merkmale als Bedingung für ein Verbündet-Sein gegeben: weder in Bezug auf Einzelpersonen noch in Bezug auf Gruppen hinsichtlich eines gemeinsamen Handelns“ (Czollek/Perko, 2017: S. 131). Die Solidarität unter- und miteinander zeigt sich im Einsatz für die Umverteilung von Privilegien und setzt keine Zugehörigkeit zu einer Gruppe voraus. Jede:r kann sich durch politisches Handeln oder/und individuelles Tun für Verteilungs- und Anerkennungsgerechtigkeit einsetzen. „Verbündete gehören im Prozess des Verbündet-Seins weder dieser oder jeder Gruppe an: Sie setzen sich ein für die Rechte und Belange von Menschen, die in anderer Weise nicht so privilegiert sind wie sie selbst“ (ebd.: S. 133-134).
Es geht an erster Stelle um Verantwortungsübernahme und um das Einsetzen und Teilen von vorhandenen Ressourcen. Dies kann in Form von Sichtbarmachung von Perspektiven der benachteiligten und diskriminierten Gruppen sein als auch in der Thematisierung von Unterdrückungsmechanismen (vgl. ebd.: S. 135). Unterstützt wird solidarisches Handeln durch Powersharing.
„Powersharing, d.h. die Teilung von Macht mit minorisierten Gruppen aus einer relativ privilegierten Position heraus, hat zwei Voraussetzungen: Zum einen aktives Zuhören seitens der beteiligten Mehrheitsangehörigen, um die selbstdefinierten Perspektiven und Interessen minorisierter Menschen zu erfahren. Powersharing bedeutet nicht, sich selbst zu beauftragen, für andere ‚mitzusprechen‘. Es geht weder um Vertretung noch um Toleranz, sondern um Machtzugang. Darüber hinaus stellt die Bewusstmachung der eigenen Privilegien und Ressourcen eine weitere Voraussetzung dar, da diese nur so gezielt eingesetzt und geteilt werden können. Wesentlich dabei ist die Frage danach, wer letzten Endes Kontrolle über Ressourcen und die Entscheidungsmacht über deren Einsatz hat. Eine Herausforderung von Powersharing besteht darin, zu respektieren, dass minorisierte Menschen andere Interessen haben und andere Entscheidungen treffen können, als es aus einer privilegierten Perspektive als ‚richtig‘ erscheint. Dazu gehört auch, das Recht von Menschen zu unterstützen, eigene Räume zu haben (zu denen man/frau selber keinen Zugang hat), eigene ‘Fehler’ zu machen und wütend, fordernd und kritisch statt dankbar zu sein“ (Rosenstreich, 2006: S. 195 ff).
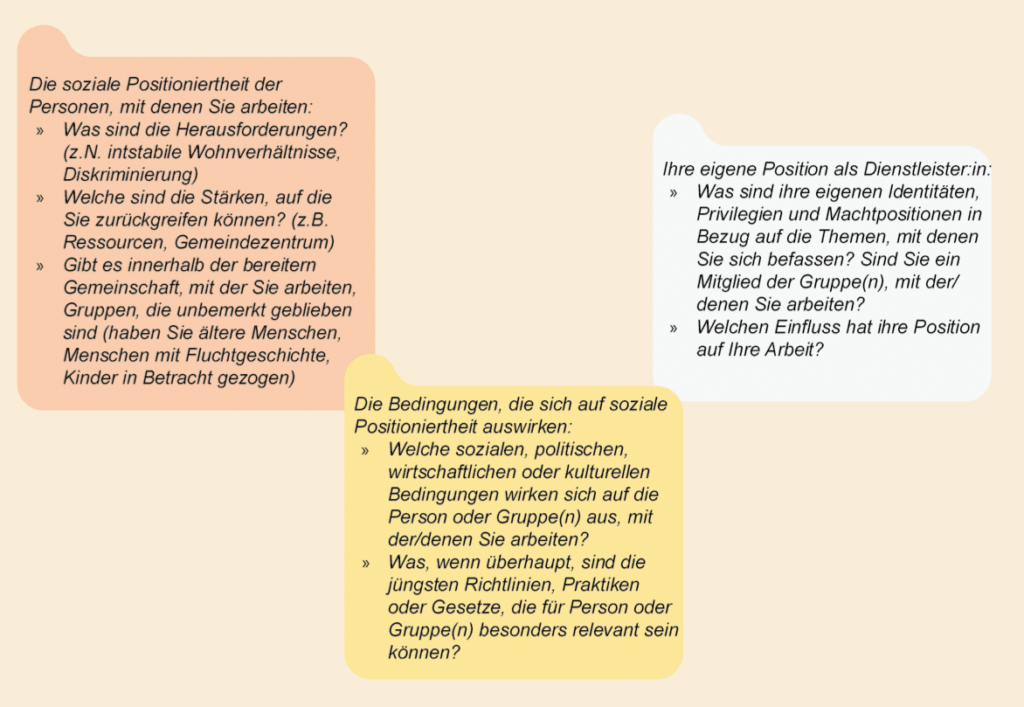
Prinzip VIII: Aus getrennten Räumen können Braver Spaces entstehen
Brave / Braver Spaces sind Räume, die Dissens und Unstimmigkeiten zulassen, aber sichere und schützende Bedingungen bieten, um diese Differenzen aufzulösen. Braver Spaces könnten aus dem Bewusstsein entstehen, dass auch reflektierte Räume nicht automatisch diskriminierungsfrei sind, andererseits in diesen Räumen gemeinsame Handlungsalternativen entwickelt werden können, wie wir gemeinsam gesellschaftliche Veränderungen schaffen können.
–
Dieser Artikel ist Teil unserer Publikation: “Handreichung: „Handlungsleitende Prinzipien. Safer Spaces für Schwarze Menschen, People of Colour und Indigenous People schaffen. Reflexionsräume für weiß positionierte Menschen initiieren” Weitere Informationen finden Sie hier
–

