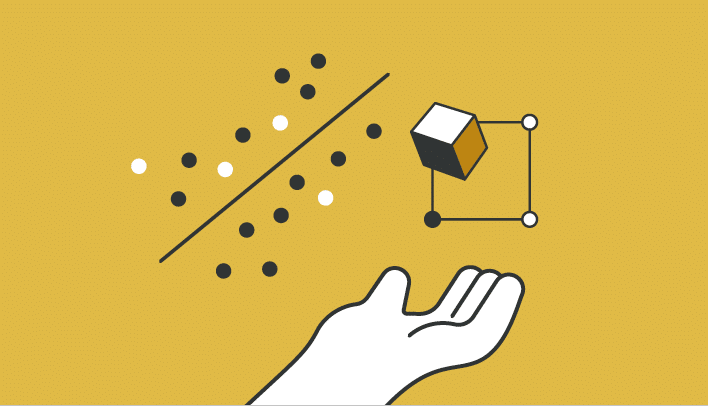Unsicherheitstoleranz bezieht sich auf die Fähigkeit einer Person, mit Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit umzugehen, ohne dabei übermäßig gestresst oder ängstlich zu werden. Es bedeutet, dass mensch in der Lage ist, sich in unsicheren Situationen wohl zu fühlen und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Eine hohe Unsicherheitstoleranz kann dazu beitragen, dass mensch besser mit Herausforderungen umgehen und neue Möglichkeiten erkennen kann. Unsicherheitstoleranz ist unterschiedlich ausgeprägt und kann sich sowohl von Person zu Person als auch von Situation zu Situation unterscheiden. In Bezug auf Organisationen, die wir im Rahmen des Projektes befragt haben, haben wir einerseits eine große Unsicherheit und andererseits eine hohe Unsicherheitstoleranz festgestellt – sowohl als auch war auch hier die Realität.
Der Großteil der befragen Organisationen war geprägt durch unsichere Strukturen. Die Aktivitäten basierten fast komplett auf ehrenamtliches Engagement und eigenen, privat erbrachten Ressourcen. Sei es bei Räumen, Technik, finanziellen Mittel, Kompetenzen, den privaten PKWs; bei den meisten Organisationen war sehr gängig, dass Engagierte diese einbrachten, um verschiedene Aktivitäten aber auch Regelangebote durchzuführen.
Hinzu kam, dass es ihnen in der Regel nicht möglich war, sich auf Projektförderung zu bewerben, was bei den meisten Förderprogrammen aber die Regel oder/und meistens das einzige Förderinstrument ist. Denn um Projekte umzusetzen, brauchen Engagierte Geschäftsführungen oder Personen, die die Anträge erstellen, Räumlichkeiten, Kommunikationstechnik, Ressourcen für die Öffentlichkeitarbeit, Verwaltungsarbeiten, Netzwerke und Kooperationen. Es liegt in der Natur der Projektförderung, dass die Basis für die Durchführung der Vorhaben nicht förderfähig ist. Das hindert auch die Diversifizierung der Projektlandschaft, denn sich neu gegründete, oder/und strukturell nicht genügend ausgestattete Organisationen kommen nicht in die Lage, sich mit ihren Vorhaben zu bewerben.
Aufgrund oder trotz der unsichereren strukturellen Bedingungen, stellten wir eine hohe Unsicherheitstoleranz fest. Projekte und Aktivitäten waren geprägt durch viel Engagement und Motivation, auch mit geringen Mitteln etwas Großartiges auf die Beine zu stellen, und dranzubleiben.
Um Unsicherheitstoleranz zu fördern, werden Kompetenzen benötigt, die Organisationen und ihren Engagierten unterstützen, mit Unsicherheiten umzugehen. Diese können sein:
- Flexibilität: Organisationen müssen in der Lage sein, sich schnell an neue Situationen und Veränderungen anzupassen. Dies erfordert eine flexible Organisationsstruktur und -kultur, die es ermöglicht, auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren.
- Offene Kommunikation: Eine offene und transparente Kommunikation ist entscheidend, um Unsicherheit zu reduzieren. Organisationen sollten eine Kultur der offenen Kommunikation fördern, in der Engagierte ihre Bedenken und Ideen frei äußern können.
- Innovationsfähigkeit: Organisationen sollten in der Lage sein, neue Ideen und Lösungen zu entwickeln, um mit Unsicherheit umzugehen. Dies erfordert eine Kultur der Innovation, in der Engagierte ermutigt werden, neue Ansätze auszuprobieren und Risiken einzugehen.
- Lernorientierung: Organisationen sollten eine Lernkultur fördern, in der Fehler als Lernchancen betrachtet werden. Engagierte sollten ermutigt werden, aus Fehlern zu lernen und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten kontinuierlich weiterzuentwickeln.
- Resilienz: Organisationen sollten über eine hohe Resilienz verfügen, um mit Unsicherheit umzugehen. Dies bedeutet, dass sie in der Lage sind, Rückschläge zu verkraften und sich schnell zu erholen.
- Leitungskompetenz: Personen in Leitungspositionen spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Unsicherheitstoleranz. Sie sollten in der Lage sein, Unsicherheit zu akzeptieren und ihre Engagierten dabei zu unterstützen, damit umzugehen. Dies erfordert eine Leitungskompetenz, die Vertrauen aufbaut und Engagierte ermutigt, Risiken einzugehen.
Mit den Kompetenzen haben die Organisationen es geschafft, zumindest vorrübergehen oder auch immer wieder Sicherheit zu ermöglichen. Nicht unbedingt darauf bezogen, dass sie die strukturelle Lage bspw. durch eine Regelförderung verbessern konnten, sondern dass sie für die Aktivitäten und Projekte einen Zustand der Sicherheit organisieren konnten. Damit hatten die an den Vorhaben Beteiligten ein Gefühl der Gewissheit und Stabilität, dass wertvoll für eine gelungene Arbeit ist.
Auf die Förderpraktiken bezogen, ergibt sich die Forderung nach langfristig angelegten Projektförderungen und die Möglichkeit auch Strukturförderungen zu beatragen. Damit kann die Unsicherheit der sozial und kreativ für unsere Gesellschaft Engagierten verringert, und Wertschätzung für die Arbeit entgegengebracht werden. Weiterhin führen langfristig angesetzte Vorhaben zu mehr Partizipation und zur Verstetigung gut funktionierender Ansätze, die auch eine Übertragbarkeit über den Projektort hinaus ermöglichen. Und damit wiederum werden Ressourcen geteilt und geschont, was unserer ganzen Gesellschaft von Nutzen ist.
Dieser Artikel ist Teil einer Publikation, die 2023 vom In-Haus e.V. veröffentlicht wurde. Für weitere Informationen und um dieses Projekt einzusehen, klicken Sie hier.