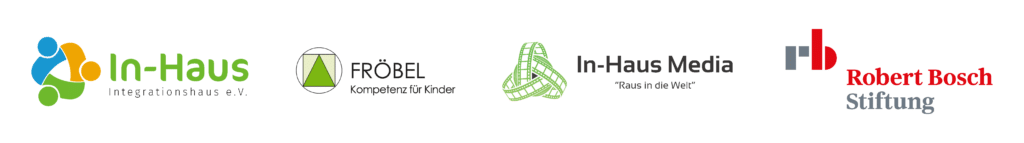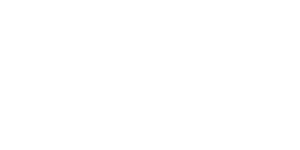Independent Women Academy / „IWA„

„…Die Zielsetzung ist der Schlüssel: Das eigene Leben so zu führen, dass es nicht durch Missstände diktiert wird, aber auch ohne Gewöhnung an die Missstände und solidarisch denen gegenüber, die nicht das Privileg haben, ihnen zu entkommen“ (Kübra Gümşay, Sprache und Sein).Die Biographien von Frauen* und Müttern, die geflüchtet oder migriert sind, sind durch soziale Determinanten und Diskriminierungen (individuell, sozial, strukturell) negativ geprägt und machen es ihnen schwer bis unmöglich, das Leben in Eigenregie zu gestalten. Aus dieser sozialer Position heraus eine berufliche Perspektive zu entwickeln, die sowohl die persönlichen Präferenzen als auch beruflichen Ziele umfasst, fällt schwer. Die existierenden Maßnahmen für Frauen, bspw. von Arbeitsagenturen etc., greifen zu kurz, da sie die spezifische Situation von geflüchteten oder migrierten Frauen und Mütter ungenügend berücksichtigen. Hier setzt das Projekt „Independent Women`s Academy“ (IWA) an. Im Vorhaben werden Frauen* und Mütter im Alter von 18-60 Jahren bei ihrer sprachlichen, beruflichen und sozialen Perspektivenentwicklung durch verschiedene Qualifizierungsangebote unterstützt, bei denen die Beteiligten beim Prozess der Entwicklung von beruflichen und sozialen Perspektiven begleitet werden, um ihre Chancen in Qualifizierungs-maßnahmen, Ausbildung und Beruf zu verbessern. Ebenso werden ungünstige Rahmenbedingungen und strukturelle Ausgrenzungsprozesse in den Blick genommen, so dass auch eine diversitätssensible Qualifizierung an den Lernorten Integrationskursträger, Berufsschulen, Unternehmen, öffentliche Verwaltung angeboten wird. Der Empowermentgedanke ist tragend für das Vorhaben. Wir möchten uns solidarisch für gerechtere gesellschaftliche Bedingungen für Frauen* und Mütter einbringen und damit auch die Ressourcen und Kompetenzen, die geflüchtete oder migrierte Menschen in sich tragen, in den Mittelpunkt stellen.
Das Vorhaben geht 2 Problemlagen an: 1. Fehlende passgenaue Angebote für geflüchtete Frauen* und Mütter; 2. Mangelnde Berücksichtigung der Lebenssituation von geflüchteten und migrierten Frauen* und Mütter. Zu 1.: Die strukturelle Benachteiligung von Frauen* und Müttern existiert weltweit, so dass geflüchtete oder migrierte Frauen* und Mütter sich teilweise noch nie in der Situation befanden, sich eine berufliche Perspektive vorzustellen, da es gar keine Angebote aber auch keine Vorbilder gab, diese Lebensperspektiven zu entwickeln. Auch führt die Flucht oder Migration, dazu, dass tradierte Geschlechterrollen (wieder) übernommen werden, so dass Frauen* und Mütter einen relativ langen Zeitraum zu Hause verbringen. Hinzu kommen noch strukturelle Bedingungen, wie Arbeitsverbote, Wohnsitzauflagen etc., die die Entwicklung einer beruflichen Perspektive verhindern. Zu 2.: Aus langjähriger Beratungs- und Projektarbeit wissen wir: Es existieren zwar schon zahlreiche Qualifizierungsangebote seitens staatlicher Institutionen, aber die Integration vor allem in den ersten Arbeitsmarkt für geflüchtete und migrierte Frauen* hat noch zahlreiche Leerstellen. Zum einen liegt es an den insgesamt für Frauen* und Mütter ungünstigen gesellschaftlichen und strukturellen Rahmenbedingungen. Und zum anderen an der mangelnden Diversitätssensibilität des Arbeitsmarktes. An diesen Beiden Problemlagen setzt IWA an und möchte durch Qualifizierungsangebote zu einer Verbesserung der Situation beitragen.
Haupziel der beiden projektgestaltenden Organisationen ist die Förderung der beruflichen Perspektivenentwicklung von geflüchteten und migrierte Frauen* und Mütter durch diverse Bildungsangebote und die Erweiterung des Berufswahlspektrum. Gleichzeitig gibt es Räume, in denen Empowerment und Resilienzförderung im Fokus stehen. Hier sollen sich die Beteiligten über Diskriminierungs-, Stigmatisierungs- und Ausgrenzungserfahrungen unterschiedlichster Art auszutauschen können, und durch das Teilen von Bewältigungsstrategien und dem Bewusstwerden der vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen Energie und solidarische Power finden, die beruflichen Ziele anzugehen. In Bezug auf die zweite Zielgruppe, Qualifizierungsträger und Arbeitgebenden, sollen Prozesse der diversitätssensiblen Öffnung von Institutionen und Organisationen durch Workshops unterstützt werden. Dabei dienen Erfahrungswerte des Bildungspartners als auch dieses Kooperationsprojekt als ein best practice für die Ansprache und den Zugang der Hauptzielgruppe, die Möglichkeit der sprachlichen (Integrationshaus) und der beruflichen Qualifizierung (Fröbel Familienzentrum), der diversitätssensiblen Öffnung durch Kooperation mit migrantischen Organisationen, die Nutzung der Mehrsprachigkeit als Ressource und der sozialraumorientierten Arbeit als Netzwerkstruktur für den Aufbau und Ausbau von Kooperationen und der gegenseitigen Unterstützung bei der Umsetzung von Projektvorhaben. Die Angebote werden in Präsenz und digital angeboten.
Unsere Projektplanung gliedert sich in drei Phasen: Vorbereitungs-, Durchführungs- und Abschlussphase. In jeder Phase werden Meilensteine festgelegt, die sich an der Zielsetzung orientieren. Hauptziel: Förderung der beruflichen Perspektivenentwicklung von geflüchteten und migrierte Frauen* und Mütter durch diverse Bildungsangebote und die Erweiterung des Berufswahlspektrum. Meilensteine hier sind das Festschreiben der Curricula der Bildungsangebote und die Organisation der Angebote (Referierendenansprache etc.), Ansprache der Teilenehmen und Organisation des Anmeldeverfahrens (inkl. Kinderbetreuung, online-Angebote etc.), Umsetzung der Angebote, Auswertung der Angebote und ggf. Nachjustierung der Zielsetzungen und deren Umsetzung regelmäßige Absprachen mit dem Bildungspartner und den weiteren Kooperationsorganisationen und Umsetzung der Öffentlichkeitarbeit,. 2. Hauptziel: Unterstützung der Prozesse der diversitätssensiblen Öffnung von Institutionen und Organisationen durch Workshops. Meilensteine hierbei sind wie oben beschrieben (in Bezug auf die Organisation von Workshops), wobei hier die Kooperation mit dem Bildungspartner als best practice für die ressourcenorientierte Arbeit dienen soll, weswegen hier verstärkt auf die Kommunikation der Kooperationsschritte investiert wird. Die Ansprachewege für die verschiedenen Zielgruppen werden entsprechend dieser angepasst und umgesetzt. Regelmäßige Teamsitzungen und Projektanpassungen werden vorlaufend stattfinden.
Hauptzielgruppe des Projektes sind junge migrierte oder geflüchtete Frauen* und Mütter (18 – 60 J.). Als Integrationskursträger, Beratungsstelle und Migranteneinrichtung mit einem mehrsprachigen Team (über 20 Sprachen) haben wir als Projektträger einen guten Zugang zur Zielgruppe und verschiedene Ansprachewege, die wir nutzen können. Vor allem werden wir die Teilnehmenden in den laufenden Integrationskursen unserer Einrichtung mehrsprachig ansprechen. Unser Bildungspartner hat ebenfalls einen guten und unmittelbaren Zugang zur Zielgruppe, da diese ihre Kinder täglich zur Betreuung in das Familienzentrum bringt. Hierbei werden wir Informationsveranstaltungen vor Ort als auch durch Elternabende im Familienzentrum auf das Angebot aufmerksam machen. Unser Bildungspartner wird uns über interessierte Personen direkt informieren. Eine weitere Zielgruppe des Projektes sind Lehrkräfte an Berufsschulen und betriebliche Mitarbeiter:innen sowie Mitarbeitende der öffentlichen Verwaltung. Den Zugang dazu besteht zum durch den Bildungspartner und seine Netzwerke, durch das Netzwerk der Interkulturellen Zentren der Stadt Köln, der Kooperation mit dem Familienzentrum der Stadt Köln, der Sozialraumkoordination Kalk und Humboldt-Gremberg sowie den Zugang zum Integrationsrat der Stadt Köln und damit zur Stadtverwaltung. Die Ansprachewege werden für die jeweilige Zielgruppe entsprechend angepasst, ebenso wird die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt entsprechend den Zielgruppen aufgebaut.
Es gibt zahlreiche Angebote für die berufliche Bildung und Qualifizierung, aber nur wenige, die sich speziell an die Projektzielgruppe richten. Wenn geflüchtete oder migrierte Frauen* und Mütter angesprochen werden, handelte es sich meisten um SGB II Maßnahmen, die unspezifische Angebote (inkl. Sanktionen) für möglichst viele Teilnehmende beinhalteten, ohne auf die spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppen einzugehen. In 2023 wird es aufgrund der Gesetzesänderungen Veränderungen geben, über die noch keine Aussage getroffen werden kann. Weiterhin wird größtenteils die Zielgruppe der Frauen* angesprochen, aber nicht der Verantwortlichen in Personalabteilungen, Berufsschulen etc. , die die Möglichkeit hätten, Rahmenbedingungen zu initiieren, die es der Hauptzielgruppe des Projektes ermöglicht, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Weiterhin haben die meisten Qualifizierungsangebote keine Kinderbetreuung, vor allem im Bereich der sprachlichen Bildung gibt es nur wenige Bildungsträger, die das Angebote der Kinderbetreuung haben. Hauptunterschied zu anderen Projekten besteht aber in der Schaffung von Räumen, in denen Empowerment und Resilienzförderung der Beteiligten im Fokus stehen. Hier können sich die Beteiligten über Diskriminierungs-, Stigmatisierungs- und Ausgrenzungserfahrungen unterschiedlichster Art auszutauschen, und durch das Teilen von Bewältigungsstrategien und dem Bewusstwerden der vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen Energie und solidarische Power finden.
Wir möchten geflüchtete Personen ansprechen, wo die Gefahr der Abschiebung, der Umverteilung in andere Kommunen, Traumata und eine insgesamt schwierige Lebenssituation eine zukunftsorientierte Lebensplanung erschweren. Da das Projekt in unserer Einrichtung stattfindet, können die Teilnehmenden das Beratungsangebot sowie weitere Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen, wodurch schwierige Lebenslagen etwas abgemildert werden können. Unsicherheit besteht auch in der Ansprache der 2. Zielgruppe des Projektes. Hierbei werden wir uns mit dem Bildungspartner beraten und bei Bedarf neue Ansprachewege kreieren und unsere Netzwerkarbeit weiter ausbauen. Das größte Risiko besteht darin, dass ungünstige Rahmenbedingungen und strukturelle Ausgrenzungsprozesse für die berufliche Lebenswegplanung von geflüchteten und migrierten Frauen* und Müttern abgebaut sowie Prozesse der diversitätssensiblen Öffnung von Institutionen nicht durch Projekte vorangetrieben werden können. Ungerechtigkeiten lassen sich durch Projekte nicht beseitigen, es braucht politischen Willen, Ressourcen und Macht, um tatsächliche Veränderungen anzustoßen. Mit unserem Projekt können wir bei einzelnen Personen Sensibilisierung für die Schwerpunkte fördern, aber ob daraus auch Handlungsschritte für die Beseitigung von ungünstigen Rahmenbedingungen erwachsen, ist nicht abzusehen. Frustration ist also ein Risiko, dem wir mit der Fokussierung auf die individuellen Erfolge der Projektteilnehmenden begegnen wollen.
Wirkung: Unser Schwerpunkt liegt in der qualitativen Auswertung der Zielerreichung. Für die Teilnehmenden, die an den weiterführenden Sprachkursen teilnehmen werden wir einen Selbstevaluationsdesign anbieten. Hierbei möchten wir die Teilnehmenden einladen, festzuhalten, wie sie sich zu Beginn des Projektes in Bezug auf Beruf und Arbeit wahrnehmen etc. und was sie sich von dem Projekt erhoffen. Nach vorab festgelegten Zeiten werden wir den Teilnehmenden während der Projektteilnahme bitten, die Selbstevaluation regelmäßig zu aktualisieren. Am Ende des 1. und 2. Kurs- und Qualifizierungsdurchlaufs werden wir diese anonymisieren und auswerten, um daraus Rückschlüsse für das und für die Weiterentwicklung von ähnlichen Angeboten und für einen möglichen Projekttransfer nutzbar machen. Ergänzt werden die Ergebnisse durch beobachtende Evaluation der jeweiligen Kursleitenden und der Referierenden. Die weiteren Qualifizierungsangebote werden wir entsprechend unserer Konzepte zur Evaluation von Bildungsangeboten mit Fragebögen evaluieren. Mit unserem Bildungspartner möchten wir gemeinsam ein Evaluationsdesign für Institutionen, Verwaltung und Bildungseinrichtungen hinsichtlich der Frage „Frauen-* und Mütterfreundliche Arbeitsplätze und Bildungsangebote“ erstellen, um hier vor allem die Perspektive bei den entsprechenden Stellen zu erweitern. Flankierend dazu werden wir quantitative Werte erfassen: TN-Zahlen im Projekt, Anschlüsse an das Projekt wir Ausbildungs- und/ider Arbeitsaufnahme etc.
Langfristige Perspektive: Den größten Nachhaltigkeitsfaktor bilden vor allem die Teilnehmenden, die an den verschiedenen Aktivitäten des Projektes partizipieren. Denn sie bringen ihre Erfahrungen ein und tragen zur Verbreitung der Projektziele- und inhalte bei. Vor allem sind sie im besten Fall Trägerinnen* der Projektziele und können als Orientierungsgebende für andere Frauen* und Mütter fungieren. Auch das im Projektverlauf entstandene Netzwerk ist mit einer Vielfalt an Ressourcen und Kompetenzen ausgestattet, die ein Fortbestehen der Projektaktivitäten in unterschiedlicher Form gewähren können, bspw. in Form von angepassten Curricula, der Entwicklung von Qualitätskriterien für die besser Einbindung von geflüchteten oder migrierten Frauen* und Müttern. Das Projekt soll dazu beitragen, dass die Lebensrealitäten unserer Projektzielgruppe sichtbarer werden und zu entsprechenden, wenn auch kleinen, strukturellen Veränderungen bei allen Beteiligten führen. Dies soll durch eine breit aufgestellte Öffentlichkeitsarbeit geschehen. Die Evaluation des Projektes dient auch dem Projekttransfer in anderen Konstellationen und Orten als auch für weitere Projekte in unserer Einrichtung. Deswegen werden die Ergebnisse in Form von einem Evaluationsbericht aber auch einem Ausblick hinsichtlich des Projekttransfers veröffentlicht. „Was sind Ihre nächsten Schritte in Bezug auf die berufliche Integration von geflüchteten oder migrierten Frauen* und Müttern?“ wird als Fragestellung in allen Angeboten diskutiert.
Förderungen und Kooperation: